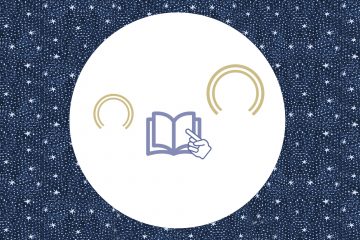Anerkennung und Bildung – mehr Mut für ein eigenes Bildungsverständnis im Ganztag
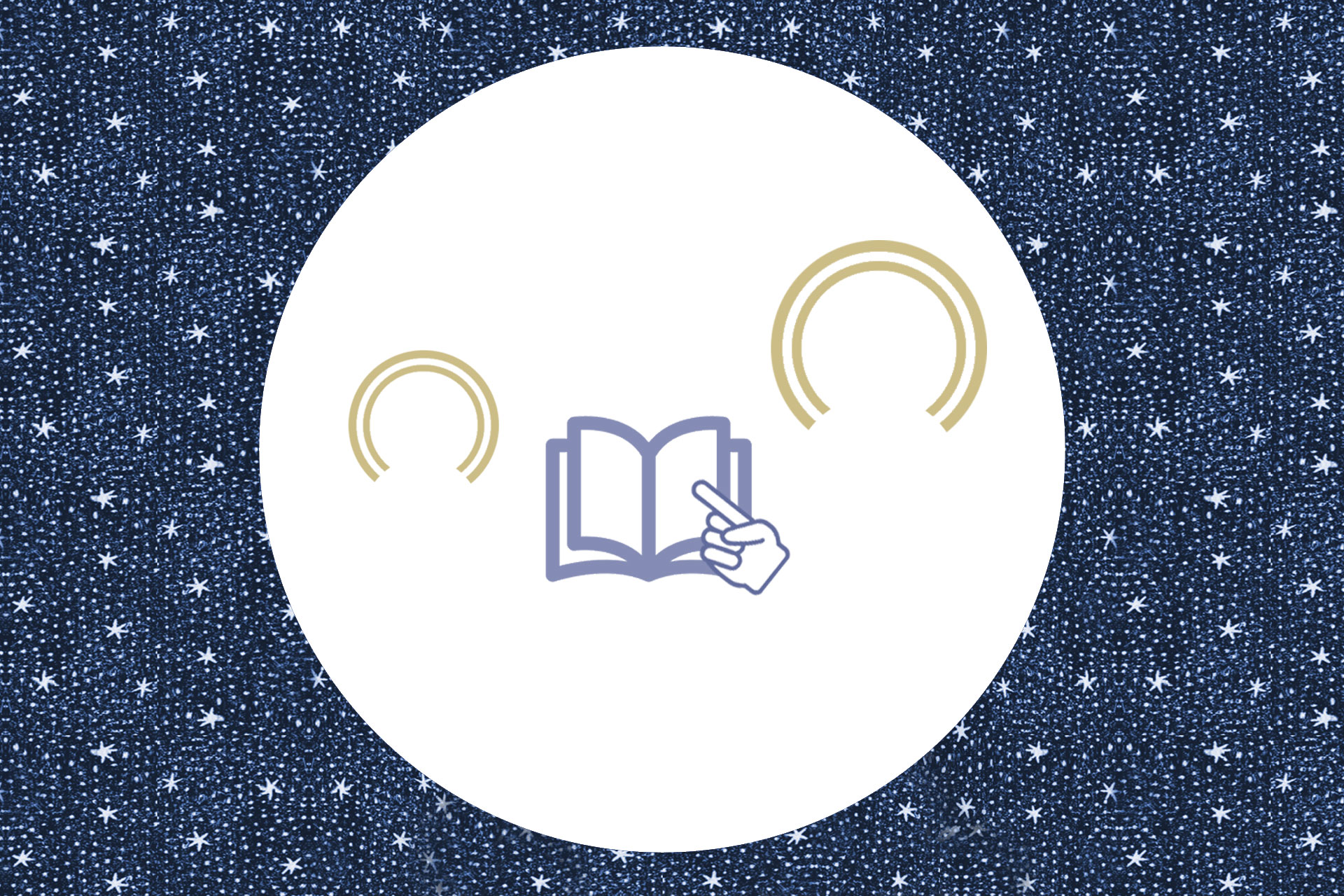
(von Ursula Winklhofer, Februar 2025)
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
Einleitung
Für die Mehrheit der Kinder im Grundschulalter gehört es inzwischen zum Alltag, nicht nur den Vormittag in der Schule, sondern auch den Nachmittag in einem der vielfältigen Modelle ganztägiger Betreuung zu verbringen. Sei es die Ganztagsschule, der Hort oder andere Kooperationsmodelle zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe – nach aktuellen Daten der Kinderbetreuungsstudie des DJI nehmen 68% der Kinder in Deutschland daran teil (Hüsken et al. 2023).
Mit diesem enormen Ausbau der letzten 20 Jahre, der zusätzlich durch den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Jahr 2026 gefördert wird, kommen auch Fragen nach der Qualität des Ganztagsangebots stärker in den Blick. Dabei fällt auf, dass der Qualitätsdiskurs stark durch die Perspektive der Organisationen bestimmt wird, so dass Fragen wie die Kooperation zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe, die Ausbildung und Gewinnung des Personals und die inhaltliche Gestaltung des Angebots im Vordergrund stehen. Aus Sicht der Eltern geht es neben einer guten Förderung und dem Wohlbefinden ihrer Kinder im Ganztag um eine für ihre Bedarfe passende und abgesicherte Betreuungszeit (Guglhör-Rudan et al. 2020; Rother et al. 2024).
Die Perspektive der Kinder selbst auf den Ganztag als Lern- und Lebensort erhält erst in jüngerer Zeit mehr Gewicht. Dabei stellt sich die Frage, was aus ihrer Sicht wichtig ist, damit sie sich in ihren Bildungsprozessen unterstützt, als Persönlichkeit wertgeschätzt und in ihren Handlungskompetenzen gestärkt fühlen (Nentwig-Gesemann & Walther 2022). Die Thematik, wie der Ganztag aus kinderrechtlicher Perspektive, im besten Interesse und mit den Wünschen der Kinder gestaltet werden kann, gewinnt in den Diskursen zum Ganztag zwar zunehmend an Bedeutung, findet in der Praxis des Ganztags jedoch noch wenig Resonanz in der konkreten Umsetzung.
Anerkennung als Leitlinie im Ganztag
Annedore Prengel hat mit ihren Arbeiten die herausragende Bedeutung einer Qualität der Anerkennung in pädagogischen Interaktionen und die immens nachteiligen Wirkungen verletzenden Verhaltens wissenschaftlich und empirisch belegt (Prengel 2019) sowie mit großem Engagement in die Praxis transferiert (Deutsches Institut für Menschenrechte et al. 2017). Die Idee der Anerkennung als eine zentrale Leitlinie für den Ganztag lässt sich noch weiter fassen: Neben der Qualität der pädagogischen Interaktionen beinhaltet Anerkennung auch, die Interessen und Bedürfnisse dieser Altersgruppe ernst zu nehmen, die sozioökonomische Lage der Kinder und ihrer Familien wahrzunehmen und nicht zuletzt ein Bildungskonzept zu entwickeln, das es allen Kinder ermöglicht, ihre Talente und Begabungen zu entfalten.
Interaktionsqualität im Ganztag – einige empirische Befunde
Aus Sicht der Kinder ist eine vertrauensvolle und sichere Beziehung mit den pädagogischen Fachkräften von zentraler Bedeutung dafür, dass sie sich in Ganztagssettings wohl fühlen können. Kinder wünschen sich von pädagogischen Fachkräften nicht nur eine professionell gestaltete, sondern auch eine persönliche Beziehungsebene, die von Freundlichkeit und Respekt geprägt ist, sowie vertrauensvolle Interaktionen, in denen sie ebenbürtig sind und ernst genommen werden (Walther et al. 2021). In der umfassenden Beobachtungsstudie INTAKT zeigte sich, dass etwa drei Viertel der pädagogischen Interaktionen in Schule und Kindertageseinrichtungen als anerkennend oder neutral eingeordnet werden können, während ein Viertel der Interaktionen als leicht oder schwer verletzend bzw. ambivalent eingestuft wurden. Dabei handelt es sich fast ausnahmslos um seelische Verletzungen, wie z. B. destruktive Kommentare, entmutigende Kritik oder Verhaltensweisen, die Kinder lächerlich machen oder bloßstellen (Prengel 2019).
Zur Interaktionsqualität im Alltag des Ganztags und im Kontext der Freizeitangebote liegen kaum empirische Ergebnisse vor, die diese detailliert durch Beobachtung oder vertiefende Interviews erfassen und genauer beleuchten. Ergebnisse standardisierter Befragungen zeichnen ein recht positives Bild einer guten Beziehung (z.B. Fischer & Kuhn 2021).
Studien, die die Hausaufgabensituation genauer untersuchen, analysieren sehr unterschiedliche Profile in den Haltungen und Interaktionsqualitäten der Fachkräfte (Nordt 2013, Wildgruber et al. 2019). Es finden sich Fachkräfte, die sich vor allem an der Kontrolle von Aufgaben und der Einhaltung von Regeln orientieren und die Leistungen und das Verhalten der Kinder eher defizitorientiert beschreiben. Die Kinder wiederum beklagen die Strenge der Fachkräfte, fühlen sich durch negative Rückmeldungen belastet und trauen sich nicht, um Hilfe zu bitten. Wird die Hausaufgabenbetreuung stärker an Akzeptanz und Autonomie ausgerichtet, sind die Bewertungen zur Beziehungsqualität und zur Feedbackkultur deutlich positiver (Nordt 2013).
Anerkennung der Bedürfnisse von Kindern im Grundschulalter
Ein zentrales Thema in diesem Alter ist die Entwicklung von zunehmender Selbständigkeit und Autonomie, so dass eigenständige Aktivitäten, die Erkundung des Wohnumfelds und allgemeine Welterkundung wichtig werden. Dabei geht es „nicht nur darum, sich in der Welt außerhalb des Elternhauses umzuschauen. Es geht vor allem darum, auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung selbst gesteckte Ziele und Herausforderungen zu bewältigen“ (Enderlein 2023, S. 114). Dies fördert das Gefühl von Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, aus eigener Kraft Herausforderungen zu bewältigen. Und es ermöglicht die Erfahrung, Verantwortung zu übernehmen und für die Gemeinschaft und die Gesellschaft nützlich zu sein. Wenn Kinder davon berichten, wie sie Artikel in der Hortzeitung veröffentlicht oder sich eigenverantwortlich um einen Obst- und Gemüsegarten auf dem Schulgelände gekümmert haben, wird deutlich, wie wichtig die Erfahrungen von Kompetenz und Selbstwirksamkeit für sie sind (Nentwig-Gesemann & Walther 2022). Dazu gehört auch der Wunsch, mitzureden und mitzuentscheiden und an der Gestaltung eines „schönen“ Ganztags beteiligt zu sein.
Für die meisten Kinder stehen Freundinnen und Freunde an erster Stelle, wenn sie gefragt werden, was ihnen im Ganztag wichtig ist (Winklhofer & Guglhoer-Rudan 2023). Mit ihnen lässt sich Zugehörigkeit, Verbundenheit und Solidarität erleben. Im Gegenzug ist es besonders belastend, wenn Kinder Ausgrenzung oder Mobbing erleben. In solchen Situationen brauchen sie die feinfühlige und wirkungsvolle Unterstützung der Erwachsenen.
Nicht zuletzt ist es ein zentrales Bedürfnis, Wissen und Können zu erwerben, sich selbst als kompetent zu erleben und möglichst eigenständig interessanten Fragen nachzugehen. Die Möglichkeit, im aktiven Tun in der Natur zu beobachten oder technische Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, einen Bach aufzustauen oder zu sägen, eine Wippe zu bauen oder Feuer zu machen, fördert naturwissenschaftliches Verstehen und technisches Verständnis (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 2023).
Anerkennung der Lebenslage der Kinder
Kinder in prekären Lebenslagen haben beim Lernen mit geringeren materiellen, bildungsbezogenen und sozialen Ressourcen zu kämpfen. Dazu gehören nicht nur eine beengte Wohnsituation, seltener ein eigenes Zimmer zu haben und eine geringere technische Ausstattung, sondern auch die Möglichkeit, die Eltern um Rat und Hilfe zu fragen. In unserer Studie „Kind sein in Zeiten von Corona: Kinder und Eltern in herausfordernden Lebenslagen“ zeigte sich sehr eindrucksvoll, wie schwierig es für Eltern ist, ihre Kinder bei den schulischen Aufgaben zu unterstützen, wenn sprachliche Hürden, niedrige Bildungsabschlüsse und geringe finanzielle Ressourcen die Lebenssituation bestimmen (Winklhofer et al. 2022). Gleichzeitig wurde deutlich, wie wenig Lehrkräfte oft über die häusliche Situation wissen und sich dementsprechend praktische Schwierigkeiten kaum vorstellen können, wie z.B., dass drei bis vier Kinder gleichzeitig in einem Raum lernen oder dass für vier Kinder nur ein Tisch für Schularbeiten zur Verfügung steht. Eltern und Kinder scheuen sich oft, ihre schwierige finanzielle Situation offenzulegen. Aufgrund von Wissenslücken tun sich Lehrkräfte schwer in der Wahrnehmung von Armutslagen von Kindern, was zu Stereotypisierungen und Stigmatisierungen im Denken und Sprechen über Familien in prekären Lebenslagen führen kann (Schneider et al. 2023).
Anerkennung als Leitlinie im Ganztag bedeutet demnach auch, sich für die Lebenssituation der Kinder zu interessieren, einen wertschätzenden und offenen Umgang mit den Eltern zu suchen und Unterstützung in guter Qualität anzubieten.
Bildung im Ganztag
Der Ausbau ganztägiger Angebote ist mit einem hohen Bildungsanspruch verbunden, denn neben einer gesicherten Betreuung ist eine stärkere individuelle Förderung und Verbesserung der Bildungschancen für alle Kinder das übergreifende Ziel. Der Ganztag bietet dafür grundsätzlich viel Potenzial, indem unterrichtliche und außerschulische Lernarrangements sich sinnvoll ergänzen und vielfältige, wie z.B. handwerkliche und künstlerische Erfahrungsmöglichkeiten bieten können (Kielblock 2023).
Doch der Blick in die Realität ist ernüchternd: Zumeist beschränkt sich das Förderangebot im Ganztag auf eine betreute Hausaufgaben- oder Lernzeit, teilweise noch ergänzt durch spezifische Förderangebote für ausgewählte Kinder. Selten wird eine Verbindung von Themen des Unterrichts mit kreativen, handlungsorientierten Angeboten im Ganztag realisiert (Fischer & Kuhn 2022, S.68). Insgesamt kommt die Forschung zu dem Ergebnis, dass sich durch den Ganztagsbesuch zwar positive Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung zeigen, jedoch nur geringe Effekte bezüglich fachlicher und überfachlicher Kompetenzen festzustellen sind. Diese lassen sich nur erreichen, wenn Angebote sehr gute Qualität aufweisen. Dazu gehört neben der dauerhaften Teilnahme vor allem eine „systematische, stark durchgearbeitete pädagogische Konzeption“, eine gute Prozessqualität in der Durchführung und die Gestaltung positiver sozialer Beziehungen (StEG Konsortium 2019, S. 5; Kielblock 2023). Diese systematische Entwicklungsarbeit findet bisher nur selten statt.
Anerkennung als zentrale Leitlinie für die Bildung im Ganztag
Wenn Anerkennung als zentrale Leitlinie für Bildung im Ganztag gelten soll, so bedeutet dies im Kern, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, ihre Begabungen und Talente zu erkennen und zu entfalten, dass sie in ihrer Individualität und ihren Potenzialen anerkannt werden. Dies erfordert im Grundsatz eine „radikale Neuausrichtung der Bildung“ (Rasfeld 2019), weg von Ziffern-Noten, Bewertungen und Vergleichen, hin zu ermutigenden pädagogischen Beziehungen, einer fehlerfreundlichen Kultur, konstruktivem Feedback und Coaching, so dass alle Kinder die Chance haben, zu „Meistern ihrer Talente“ zu werden (Rasfeld 2019, S. 1).
Methodisch gesehen braucht dieses Lernen Selbstbestimmung und Freiräume. Ein Format dafür ist der „FREI DAY“, vier Stunden pro Woche freie Zeit für Projekte, die sich an den Globalen Nachhaltigkeitszielen orientieren und Raum bieten für Kreativität, sinnstiftendes Lernen und die bereichernde Erfahrung, gemeinsam etwas zu bewegen (vgl. Rasfeld 2021, S. 90).
Diese Ideen wurden für die Schule entwickelt und in etlichen Schulen bereits umgesetzt – und im besten Fall lässt sich eine Schule darauf ein und tut dies in Kooperation mit dem Ganztag. Doch da Schulen manchmal schwer zu bewegen sind, können diese Ideen und Prinzipien auch den Ganztag mit seinen Bildungsangeboten inspirieren, umso mehr, da der Ganztag mehr Freiräume bietet, um diese umzusetzen. Erste kleinere Schritte können darin bestehen, in allen Angeboten zu prüfen, inwieweit Selbstbestimmung, Partizipation und freies Lernen möglich sind und dies in der Praxis umzusetzen (vgl. Prengel 2020).
Das Ziel wäre ein eigenständiges Bildungsverständnis für den Ganztag, das im Sinne von Annedore Prengel grundlegend von der Idee der Anerkennung getragen wird, insbesondere in der Gestaltung der pädagogischen Beziehungen, aber auch in der Anerkennung der Bedürfnisse der „großen“ Kinder, in der Wahrnehmung ihrer individuellen Lebenslage und in der Gestaltung von Bildungsprozessen, die in ermutigender Weise auf die Entfaltung der individuellen Talente und Potenziale ausgerichtet ist.
Literatur
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) (Hrsg.) (2023): Was Grundschulkinder brauchen. Bedürfnisse und Entwicklung von Sechs- bis Zwölfjährigen als Ausgangspunkt für einen guten Ganztag. Autorin: Oggi Enderlein. Berlin
Deutsches Institut für Menschenrechte Berlin; Deutsches Jugendinstitut München; MenschenRechtsZentrum an der Universität Potsdam; Rochow-Museum & Akademie für bildungsgeschichtliche und zeitdiagnostische Forschung an der Universität Potsdam (2017): Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen, Reckahn
Enderlein, Oggi (2023): Alterstypische Lebensthemen und Bedürfnisse von „Großen Kindern“ und ihre Bedeutung für die Entwicklung. In: Plehn, Manja (Hrsg.): Qualität in Ganztag, Hort und Schulkindbetreuung. Freiburg: Herder
Fischer, Natalie & Kuhn, Hans Peter (2021): Abschlussbericht der Evaluation “Pakt für den Nachmittag” (PfdN). Kassel: Universität Kassel
Guglhör-Rudan, Angelika; Winklhofer, Ursula; Gerleigner, Susanne; Alt, Christian & Langmeyer, Alexandra (2020): Qualitätskriterien für die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Expertise. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
Hüsken, Katrin; Lippert, Kerstin & Kuger, Susanne (2023): Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder – entsprechen sie den Bedarfen der Eltern? DJI-Kinderbetreuungsreport 2023. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
Kielblock, Stephan (2023): Vielfältigkeit wird möglich durch Kooperation. Zur Zusammenarbeit von Fachkräften im Interesse der Kinder. In: Pesch, Ludger; Dohle, Karin; Maywald, Jörg (Hrsg.): Ganztag im besten Interesse der Kinder. Freiburg: Herder, S. 100 – 110
Konsortium der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) (2019): Individuelle Förderung: Potenziale der Ganztagsschule. Frankfurt am Main
Nentwig-Gesemann, Iris & Walther, Bastian (2022): Den pädagogischen Alltag für und mit Kinder(n) zum Wohl des Kindes gestalten. In: Deutsches Jugendinstitut / Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (Hrsg.): Ganztag für Grundschulkinder. Grundlagen für die Kompetenzorientierte Weiterbildung. WiFF Wegweiser Weiterbildung, Bd. 16, München, 46–55
Nordt, Gabriele (2013): Lernen und Fördern in der Hausaufgabenpraxis der offenen Ganztagsgrundschule in Nordrhein-Westfalen. Eine qualitative Studie aus der Perspektive der pädagogischen Kräfte und der Kinder, Münster
Prengel, Annedore (2019): Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz, Opladen
Prengel, Annedore (2020): Ethische Pädagogik in Kitas und Schulen. Weinheim: Beltz
Rasfeld, Margret (2019): Plädoyer für eine radikale Neuausrichtung der Bildung. In: Pädagogische Führung, 30, (5), 164-167
Rasfeld, Margret (2021): FREI DAY. Die Welt verändern lernen! Für eine Schule im Aufbruch. München: oekom verlag
Rother, Pia; Sauerwein, Markus & Fischer, Natalie (2024): Qualität in der Ganztagsschule – Qualität im Ganztag. In: Soziale Passagen, 16, 1-16
Schneider, Ramona; Lüring, Klara; Steiner, Christine; Zerle-Elsäßer, Claudia & Steinberg, Hannah Sinja (2023): Polarisierungen im Kontext Schule. Marginalisierungsprozesse am Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I aus Sicht von Schulakteur/-innen und Schüler/-innen. In: Villa, Paula-Irene (Hrsg.): Polarisierte Welten. Verhandlungen des 41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2022. https://publikationen.soziologie.de/index.php/kongressband_2022/article/view/1608
Wildgruber, A.; Schuster, A. & Fischer, S. (2019): Weiterentwicklung der Hausaufgabenpraxis in Horten und Häusern für Kinder. Bericht der Wissenschaftlichen Begleitung des Projektes in Stadt und Landkreis Rosenheim, IFP-Projektbericht 35/2019, München
Winklhofer, Ursula, Chabursky, Sophia & Langmeyer, Alexandra (2022): Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Distanzlernen. Ergebnisse der Studie „Kind sein in Zeiten von Corona“. In: Budde, J.; Lengyel, D., Böning, C.; Claus, C.; Weuster, N. & Schroedler, T. (Hrsg.): Schule in Distanz – Kindheit in Krise. Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Wohlbefinden und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen, Wiesbaden, 199–226
Winklhofer, Ursula & Guglhör-Rudan, Angelika (2023): Ganztagsbildung im Interesse der Kinder. Vortrag auf der Tagung „Gute Ganztagsbildung für Grundschulkinder“, 06. Mai 2023, Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Bayern. https://www.gruene-fraktion-bayern.de/themen/bildung-wissenschaft/gute-ganztagsbildung-fuer-grundschulkinder-packen-wir-es-gemeinsam-an
Autorin und Bezug zu Annedore Prengel
Im Sommer 2012 bist du, Annedore, nach München gefahren zu einem Gespräch mit Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts (DJI), um das DJI für eine Beteiligung an der Internationalen Tagung „Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen“ zu gewinnen. Das ist dir gelungen, und ich durfte die Aufgabe übernehmen, gemeinsam mit dir und dem Deutschen Institut für Menschenrechte die Tagung zu gestalten. Dies war der Beginn unserer Zusammenarbeit, die bis heute weiter besteht: Mit der Herausgabe der Tagungsbände und den Treffen im Expertenkreis, der Entwicklung der Reckahner Reflexionen und ihrer Verbreitung sowie der Schultagung im letzten Jahr waren viele erfüllende und inspirierende Erfahrungen verbunden. Herzlichen Dank dafür, liebe Annedore!