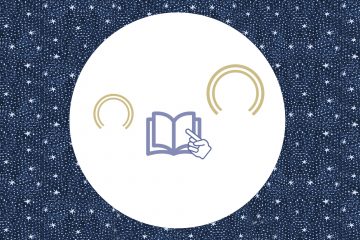Das Geschlecht in der pädagogischen Beziehung
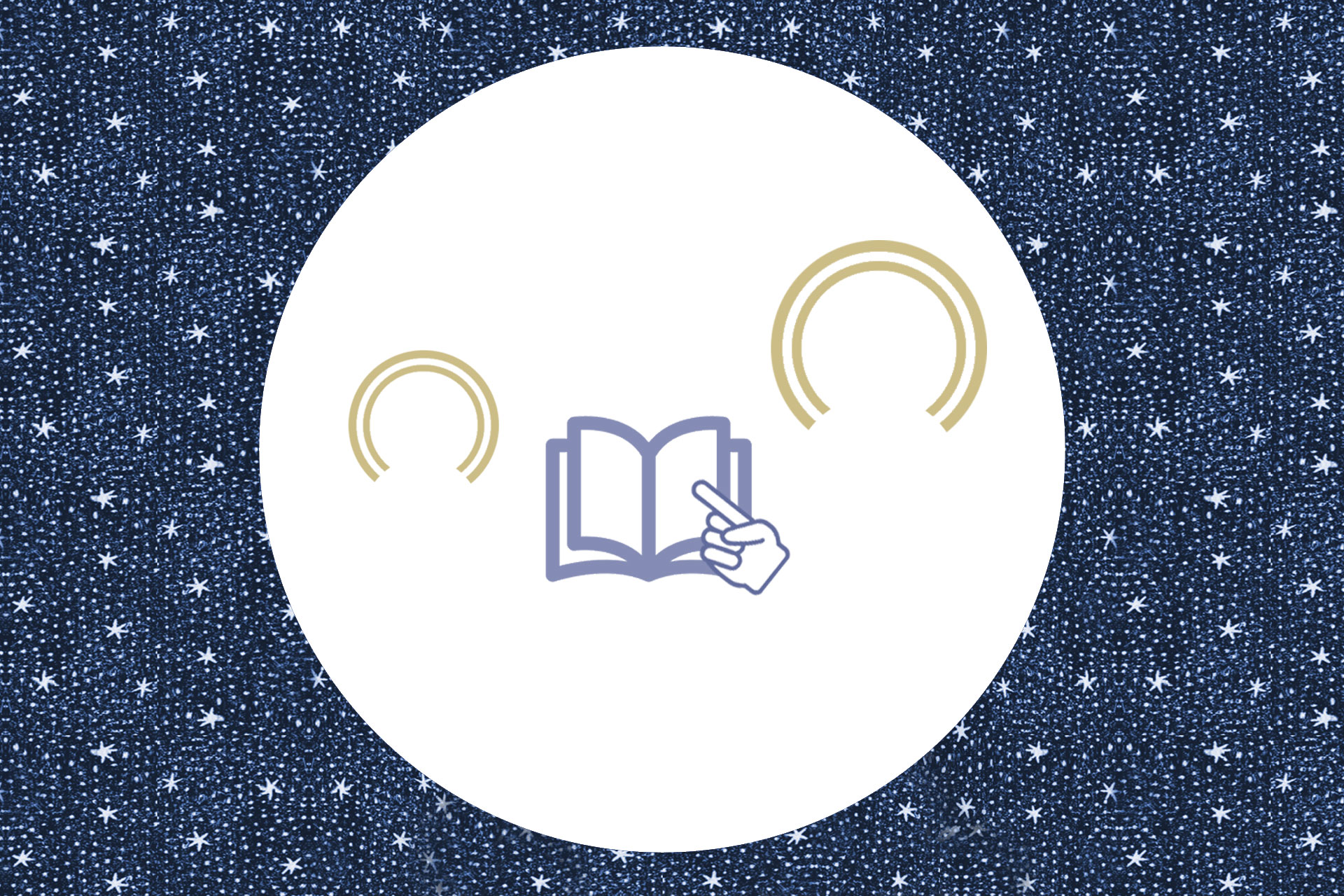
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
(von Margitta Kunert, Juli 2025)
Dieser Beitrag betrachtet die pädagogische Beziehung aus der Perspektive der geschlechterbewussten Pädagogik in außerschulischen sozialpädagogischen Feldern. In den Reckahner Reflexionen wird das Geschlecht der Kinder und Jugendlichen als ein Gegenstand der Nichtdiskriminierung unter anderen genannt. Die feministische Pädagogik hat die Thematisierung von Geschlecht in pädagogischen Kontexten und die Auswirkung von Geschlechterhierarchien auf Bildungs- und Entwicklungsprozesse schon früh untersucht (vgl. Prengel 1995, S.96 f). Mit den Entwürfen zur Genderkompetenz in sozialpädagogischen Feldern wurde ein Professionsprofil vorgelegt, das hinsichtlich der Herausbildung pädagogischer Beziehungen aufschlussreich sein kann (Kunert-Zier 2005, S. 281f). Im Folgenden werde ich den Versuch unternehmen, die Anschlussmöglichkeiten dieser Entwürfe an die Reckahner Reflexionen auszuloten und insbesondere darzulegen, dass die Ergänzung der Reckahner Reflexionen um eine geschlechterbewusste Perspektive relevant und sinnvoll ist, um den Kindern und Jugendlichen besser gerecht zu werden.
Ansätze geschlechtsbezogener Pädagogik haben sich seit den 1970er Jahren in Jugendzentren und anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe in Form von Mädchen*- und Jungen*arbeit, als geschlechterreflexive Koedukation hin zu einer sich als heteronormativitätskritisch, intersektional, diskriminierungssensibel und queerfeministisch verstehenden Pädagogik mit allen Geschlechtern entwickelt (vgl. Wallner f. LAGs Sachsen e.V. (Hrsg.) 2020).
Wichtige Impulse dafür wurden in der Pädagogik der Vielfalt (Prengel 1995) gegeben, in der die Feministische Pädagogik neben der Interkulturellen und der Integrationspädagogik als Pädagogiken der Erprobung von Verschiedenheit und Gleichberechtigung aufgeschlossen und für eine diversitätsbewusste Pädagogik erste Weichen gestellt wurden. Die Elemente einer Pädagogik der Vielfalt (a.a.O., S. 184 f.) formulierten Grundlagen der pädagogischen Beziehung, die immer noch aktuell und handlungsleitend sind. Aus heutiger Sicht kann die Pädagogik der Vielfalt Fundament für die geschlechter- und diversitätsbewusste Pädagogik gesehen werden.
Ansätze geschlechtersensibler Pädagogik haben Einzug in die Bildungspläne von Kindertagesstätten genommen (z. B. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 2010), und wurden theoretisch und methodisch fundiert ( Focks 2016, Rohrmann/ Wanzeck-Sielert 2023, Schaich 2023). In der Kinder- und Jugendarbeit wurden entsprechende Leitlinien als Bestandteile von Förderrichtlinien verabschiedet, z. B. der Orientierungsrahmen für eine genderbezogene Kinder- und Jugendarbeit in Frankfurt a. M. (Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt a. M. 2013). Außerdem definiert das Kinder- und Jugendhilferecht: „Bei der Ausgestaltung und der Erfüllung der Aufgaben sind (…) die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern.“ (§ 9 SGB VIII)
Mit der gewachsenen Aufmerksamkeit für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, der Relevanz intersektionaler Perspektiven und dem Anspruch heteronormativitätskritisch und diskriminierungssensibel zu arbeiten ist die genderbewusste Pädagogik komplexer und für die pädagogischen Fachkräfte herausfordernder geworden (Kunert 2022, 205 f.)
Nicht erst der queer-feministische Blick fordert die Selbstreflexion des eigenen Umgangs pädagogischer Fachkräfte mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Die Möglichkeit der Eintragung „divers“ in das Personenstandsregister 2018 sowie das ab Nov. 2024 in Kraft tretende Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBBG), das bereits 14-Jährigen ermöglicht, sich einem anderen als dem bei der Geburt festgestellten Geschlecht zuzuordnen, fordert auch die pädagogischen Fachkräfte. Sie benötigen umfassende Kenntnisse und eine eigene Haltung gegenüber Trans-, Inter- und Non Binären Kindern und Jugendlichen. Dieses Wissen wurde in (sozial-)pädagogischen Studiengängen und in der Ausbildung von Erzieher*innen bislang nicht systematisch vermittelt. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte ist diesbezüglich gefordert. Nicht nur die Begleitung von geschlechtlich vielfältigen Kindern und Jugendlichen, sondern auch die Arbeit mit deren Eltern sowie die entsprechende Positionierung von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sind neue zu bewältigende Aufgaben.
Diese Prozesse finden überdies in einem gesellschaftlichen Klima des steigenden Antifeminismus, Rassismus, Rechtspopulismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit statt. Die pädagogischen Fachkräfte und die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind angehalten, sich dagegen deutlich politisch zu äußern.
Die pädagogischen Fachkräfte bewegen sich ständig im Spannungsfeld der Auseinandersetzung mit geschlechtsbedingen Benachteiligungen ihrer Zielgruppen und dem Anspruch, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern (§ 1SGB VIII). Dafür sind Selbstachtung und die Anerkennung der anderen zentral (Prengel 1995, 185, Reckahner Reflexionen 2017, 4 ).
Genderkompetenz in der pädagogischen Beziehung
Das für sozialpädagogische Felder entwickelte Professionsprofil „Genderkompetenz“ sieht neben fachwissenschaftlichen und praxisbezogenen methodischen Kompetenzen vor allem genderbewusste Selbstkompetenzen vor (Kunert-Zier 2005, 281 f). Die drei Kompetenzen entfalten ihre professionelle Wirkung in einem gleichrangigen Zusammenspiel. Die genderbewusste Selbstkompetenz kann als ein Gradmesser für die pädagogische Qualität in diesem Handlungsfeld gesehen werden.
Genderkompetente pädagogische Fachkräfte reflektieren in hohem Maß ihr Verhältnis zum eigenen und zu anderen Geschlechtern. Ziel der Genderpädagogik ist es, Kinder und Jugendliche bei der Ausgestaltung einer eigensinnigen möglichst selbstbestimmten Definition ihres Geschlechts zu fördern und zu begleiten. Unter geschlechtsbewusst verstehe ich, die Selbstgewissheit der pädagogischen Fachkräfte über den eigenen Umgang mit Geschlechtern und sexuellen Orientierungen, die Kenntnis der eigenen genderbezogenen Wirkungen auf andere, die Fähigkeit, sensibel die Grenzen der Bearbeitung von Geschlechterthemen im Hinblick auf die Zielgruppen auszuloten und dafür angemessene Methoden zu finden.
In der Genderpädagogik hat sich eine genderreflexive Subjektorientierung gegenüber einer in den Anfängen formulierten Stärkung von Geschlechtsidentität durchgesetzt (vgl. Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main 2011, S.11, 45 f. ). Dies bedeutet, in Kenntnis geschlechtsbedingter Benachteiligungen Kinder und Jugendliche nicht in erster Linie in ihrem Geschlecht, sondern sie als suchende Individuen zu sehen. Genderkompetenz ist von einer fragenden Haltung gegenüber den Adressat*innen sowie der Anerkennung von Ungewissheit, Ambivalenzen und einer prinzipiellen Unbestimmbarkeit von Geschlecht getragen (Kunert 2022,205). Intersektionale Perspektiven erfordern es, Geschlecht immer auch im Kontext zu anderen Benachteiligungskategorien zu sehen. Angesichts der Diversität familiärer, ökonomischer und kultureller Hintergründe scheint die Subjektorientierung am meisten geeignet zu sein, Kindern und Jugendlichen in ihrem Sozialisationsprozess gerecht zu werden.
In aktuellen Diskursen der Genderpädagogik wird gefordert, dass pädagogische Fachkräfte diskriminierungssensibel ihren eigenen Umgang mit Ableismus, Bodyshaming, Disability, Klassismus, Lookismus, Privilegien, Rassismus, Sexismus, Weiß-Sein (critical whiteness) immer wieder auf den Prüfstand stellen (vgl. LAG-Mädchenarbeit in NRW e.V. 2017).
Vorbilder für gelebte Geschlechterdemokratie
Pädagogische Beziehungen sind in einer geschlechterbewussten Pädagogik durch das Generationenverhältnis, das beruflich bedingte Machtgefälle, den professionellen Auftrag, aber vor allem durch das mehr oder weniger präsente Geschlecht der Akteur*innen aufgeladen. Die Persönlichkeit der pädagogischen Fachkräfte ist ihr „erstes Arbeitsmittel“. Sie sind immer Vorbilder. Pädagogische Fachkräfte werden in der Kinder- und Jugendarbeit als „erwachsene Freund*innen“, „großer Bruder oder Schwester“ „öffentliche Mütter bzw. Väter“ bezeichnet (vgl. Kunert-Zier 2005: 189f. u. 251f.) Sie sind immer Role Models für ihr jeweiliges Geschlecht und in Interaktionen mit Kindern und Jugendlichen wie gegenüber Erwachsenen Vorbilder für die Qualität von Geschlechterverhältnissen. Ein respektvoller von Anerkennung und Wertschätzung geprägter Umgang zwischen pädagogischen Fachkräften aller Geschlechter kann als Modell für egalitäre Geschlechterbeziehungen im Sinne einer „Gelebten Geschlechterdemokratie“ gesehen werden (Kunert-Zier 2013).
Umsetzung der Reckahner Reflexionen in der geschlechterbewussten Pädagogik
Die Reckahner Reflexionen fordern, Anerkennung und Wertschätzung in den Vordergrund pädagogischer Interaktionen zu stellen und dadurch einen positiven Einfluss auf die Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen zu nehmen.
Anerkennung und Wertschätzung bedeuten in der geschlechterbewussten Pädagogik, dass Kinder und Jugendliche insbesondere in der Art und Weise, wie sie ihr Geschlecht repräsentieren anerkannt und gewürdigt werden. Das kann insbesondere im Jugendalter, in dem die Suche nach Identität zentral mit den eigenen Vorstellungen von Geschlecht verknüpft sind, von Ambivalenzen geprägt sein. Jugendliche probieren verschiedenen Performances von Geschlecht aus, sie experimentieren mit Wirkungen von Kleidung, Frisuren, Schminke, sie wechseln ihre Styles und testen Grenzen aus. Jugendliche in dieser Phase pädagogisch zu begleiten, erfordert Großzügigkeit. Schönheitsideale oder überzogene Männlichkeitsbilder können diese Prozesse stark überlasten. Für pädagogische Fachkräfte heißt dies, sich selbst mit diesen Mustern auseinander zu setzen, über ein hohes Maß an Selbstkenntnis der eigenen Repräsentation von Geschlecht und eigenen Haltungen gegenüber den unterschiedlichen Weiblichkeits- und Männlichkeitsvorstellungen, Moden und Normen zu verfügen. Gleichzeitig suchen Jugendliche in der Phase der Ablösung von den Eltern nach neuen Beziehungen zu Erwachsenen, die sie als Heranwachsende und nicht mehr als Kinder betrachten. Pädagogische Fachkräfte können in dieser Hinsicht Halt und Orientierung bieten unter Beachtung der Ausgewogenheit von Nähe und Distanz. Austauschmöglichkeiten unter den pädagogischen Fachkräften über die gegenseitige Wahrnehmung sind notwendig und wertvoll.
Reflexion der eigenen Repräsentationen von Geschlecht
Die genderbewusste Pädagogik erfordert eine ständige Reflexion der eigenen Repräsentation von Geschlecht sowie der eigenen Haltung gegenüber Diskriminierungen jeglicher Art. Diese Selbstvergewisserung ist ein elementarer Bestandteil pädagogischer Professionalität. Wenn pädagogische Fachkräfte im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Individuen fördern sollen, benötigen sie selbst ein gut reflektiertes Wissen über ihre eigenen Kompetenzen und Wirkungen auf andere.
Die Förderung von Selbstbestimmung in pädagogischen Kontexten setzt voraus, dass auch pädagogische Fachkräfte ihr persönliches Verhältnis zu Selbst- und Fremdbestimmung reflektieren. Sie sollten über ein Bewusstsein der eigenen Potentiale und Grenzen verfügen, denn, wenn sie sich selbst mit eigenen Stärken und Schwächen, Bedürfnissen und Ambivalenzen akzeptieren, können sie dieses auch gegenüber ihren Zielgruppen tun. Die Selbstannahme hinsichtlich des eigenen Geschlechts, die eine Zielsetzung der Genderpädagogik ist, gilt genauso für die pädagogischen Fachkräfte!
Die Inhalte des Reckahner Regelbüchleins sollten auch bei den pädagogischen Fachkräften selbst ihre Relevanz entfalten. Das Beharren auf einer eigenen Würde, auf Nein-Sagen und Hilfe holen gilt auch für sie.
Literatur
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration/ Hessisches Kultusministerium
( 2019 ): Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen, 9. Auflage, Wiesbaden
Focks, Petra (2016): Starke Mädchen, Starke Jungen. Genderbewusste Pädagogik in der Kita. Freiburg. Basel. Wien. Verlag Herder
Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main (2011): Der gehaltene Raum. Dokumentation Genderprojekt Frankfurt: https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/publikationen/jugend–und-sozialamt/junge-menschen-und-jugendhilfeplanung/dokumentation-des-gender-projektes-der-gehaltene-raum
Kunert-Zier, Margitta (2005): Erziehung der Geschlechter. Entwicklungen, Konzepte und Genderkompetenz in sozialpädagogischen Feldern, Wiesbaden. VS-Verlag
Kunert-Zier, Margitta (2013): Gelebte Geschlechterdemokratie von Anfang an. Genderkompetente Kita-Teams als Vorbilder und Chance. Vortragsmanuskript: https://docplayer.org/41092416-Gelebte-geschlechterdemokratie-von-anfang-an-genderkompetente-kita-teams-als-vorbilder-und-chance.html
Kunert, Margitta (2022): Genderkompetenz, in: Ehlert, Gudrun/ Funk, Heide/ Stecklina, Gerd (Hrsg.): Grundbegriffe Soziale Arbeit und Geschlecht. Weinheim/Basel, S. 203-207 . Beltz/Juventa
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e. V. (2017): MÄDCHEN*ARBEIT RELOADED. Qualitäts- und Perspektiventwicklung (queer) feministischer und differenzreflektierter Mädchen*arbeit, Wuppertal: https://maedchenarbeit-nrw.de/wp-content/uploads/2021/02/handreichung-11219.pdf
Prengel, Annedore (1995): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik, 2. Auflage, Opladen. Leske und Budrich
Rohrmann, Tim/ Wanzeck-Sielert, Christa (2023): Mädchen und Jungen in der KiTa. Körper, Gender, Sexualität, 3. aktualisierte Auflage, Stuttgart.
Schaich, Ute (2023): Gender in Kinderkrippen. Wie Geschlecht bedeutsam gemacht wird. Eine ethnographische Studie, Opladen. Berlin. Toronto
Wallner, Claudia für die Landesarbeitsgemeinschaften Mädchen* und junge Frauen* , Jungen- und Männerarbeit, Queeres Netzwerk Sachsen e.V. (Hrsg.) (2020) Fachexpertise zur geschlechterreflektierenden Arbeit mit jungen Menschen im Rahmen des SGB VIII, Dresden: https://www.juma-sachsen.de/files/2020/02/GR_Fachexpertise_SN.pdf
Zu meiner Person
Prof. Dr. Margitta Kunert, Erziehungswissenschaftlerin und Sozialpädagogin, Professorin für Pädagogik in der Sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, (2008-2020) Schwerpunkte: Bildung in der Sozialen Arbeit, Geschlechterbewusste Kinder- und Jugendarbeit, Demokratie und Wertebildung, Pädagogik des Raums; Mitglied in der Expertengruppe zur Ethik pädagogischer Beziehungen in Reckahn; seit 2023: Professorin für Diversität in der Sozialen Arbeit an der HS Fresenius, FB Gesundheit & Soziales Frankfurt a. M.
Bezug zu Annedore Prengel
Annedore Prengel betreute meine Dissertation „Erziehung der Geschlechter. Entwicklungen, Konzepte und Entwürfe für eine genderkompetente Professionalität in sozialpädagogischen Feldern – Eine Analyse von Praxismodellen und qualitativem ExpertInneninterviews“ von 1998 bis 2003. Seither sind wir in Kontakt, der sich durch meine aktuelle Mitarbeit in der Expertengruppe zur Ethik pädagogischer Beziehungen fortsetzt.