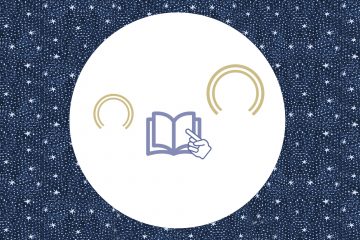„Endlich habe ich einen Rahmen für diese ganzen Konzepte“ – Wie die Reckahner Reflexionen die Kita-Praxis bereichern können
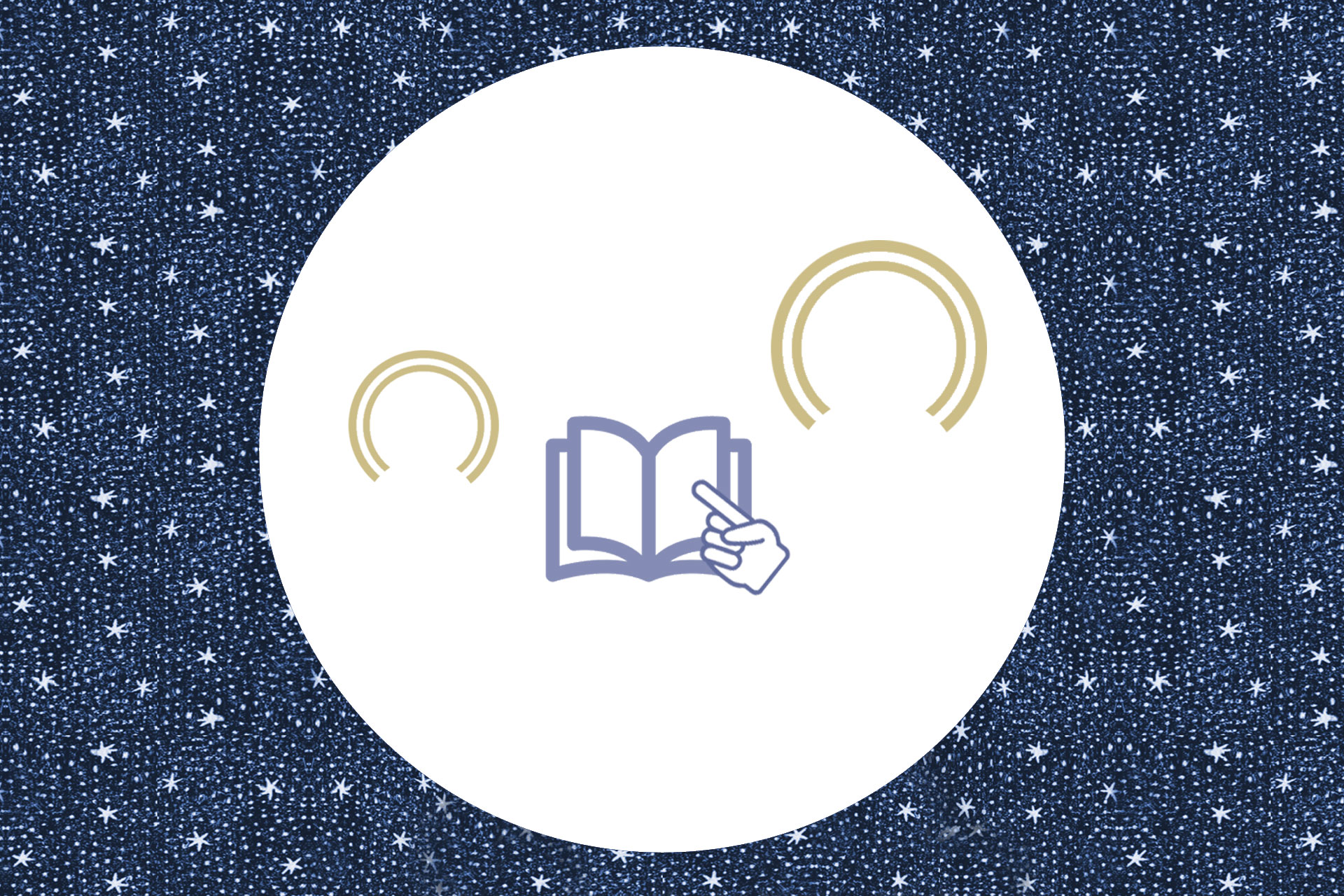
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
(von Jennifer Lambrecht, Juli 2025)
„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, sich mit dem wichtigen Thema der Beziehungen zu beschäftigen“, beginne ich häufig meine Fortbildungen mit Kita-Fachkräften zu diesem Thema – und auch diesen Beitrag. Das Beziehungsthema rückt in Teambesprechungen und Fortbildungen oft in den Hintergrund, obwohl es im Alltag ständig präsent ist. Wenn andere Themen gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen, schlägt sich dies in den Fortbildungsprogrammen nieder. So ergab eine Suche im Fortbildungsprogramm des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg 104 Übereinstimmungen mit dem Thema „Medien“, 45 mit „Mathe“, beeindruckende 559 zu „Sprache“ und ganze 0 Treffer zum Stichwort „Beziehung“. Im Fortbildungsprogramm des Kita-Trägers, von dem ich hier berichte, sind es immerhin 21 Treffer für „Beziehung“, doppelt so viele für „Medien“ und mehr als dreimal so viele für „Sprache“.
Beziehung bleibt ein Nischenthema – und ist dennoch zentral

Die Bedeutung anerkennender Beziehungen für die kindliche Entwicklung ist sowohl wissenschaftlich (Pianta, 2014; Prengel, 2020) als auch bildungspolitisch anerkannt. „Bildung braucht Bindung und Beziehung“, heißt es im Berliner Bildungsprogramm für Kita und Kindertagespflege (BBP, S. 16). Dazu, wie genau anerkennende Beziehungen gestaltet werden sollten, findet sich jedoch wenig in den Bildungs- und Fortbildungsprogrammen der Länder. Gleichwohl gibt es verschiedene Fachthemen, die letztlich auf die Gestaltung der Beziehung abzielen: Bedürfnisorientierung, Demokratiepädagogik, Antidiskriminierung und vieles mehr.
Die Verantwortung steigt
Die Verantwortung, die an die Kitas herangetragen wird, stieg in den letzten Jahrzenten. Längst geht es nicht nur um Betreuung. Vielmehr wird der Kita als frühkindlicher Bildungseinrichtung eine wichtige Rolle in der Möglichkeit der Kompensation sozialer Ungleichheit zugeschrieben (Köller et al., 2020). Die Ansprüche an die Qualität der Kitas und an die Ausbildung des pädagogischen Personals steigen – wenngleich das System durch akuten Personalmangel stark belastet ist (DKLK-Studie, 2023). Dieser Stress belastet auch die Beziehung zu den Kindern (ebd.). Wenn ich pädagogische Fachkräfte frage, was Gründe dafür sein können, dass es nicht gelingt, anerkennende Beziehungen zu gestalten, ist die Antwort meistens: „Stress. Keine Zeit“. Empirische Studien hingegen zeigten eine tendenzielle Unabhängigkeit verletzend agierender Fachkräfte von Rahmenbedingungen (Tellisch & Prengel, 2019; Hildebrandt et al., 2021) – ein Befund, auf den die pädagogischen Fachkräfte in meinen Fortbildungen irritiert reagieren.
Ein Mangel an Zeit für die Arbeit sowie der Mangel an monetärer und gesellschaftlicher Anerkennung stellen zudem markante Belastungsfaktoren für pädagogische Fachkräfte dar (Gambaro et al., 2021).
Bitte nicht noch etwas Neues!
Es überrascht mich deshalb nicht, wenn pädagogische Fachkräfte skeptisch reagieren, wenn ich mit einem Rucksack voll Material – Broschüren und Flyer – zu den Reckahner Reflexionen ankomme. Die Erleichterung ist oft groß, wenn die Fachkräfte feststellen, dass die Reckahner Reflexionen im Kern „nur“ 10 Leitlinien sind. Sechs davon beschreiben ethisch begründete und vier ethisch unzulässige Handlungsweisen pädagogischer Fachkräfte. Eine Teilnehmerin sagte in einer Abschlussrunde: „Zuerst dachte ich, oh nein, was kommt da jetzt schon wieder, was sollen wir denn noch alles machen? Aber dann habe ich gemerkt: Das ist ja gar nichts Neues, das machen wir ja schon.“
Die Reckahner Reflexionen sind anschlussfähig an das alltägliche Handeln der Fachkräfte. Es geht nicht darum etwas komplett Neues zu implementieren. Vielmehr geht es darum, die vorhandene Praxis bewusst zu reflektieren. Für die Umsetzung vieler Leitlinien braucht man nicht mal mehr Zeit – Ein „Danke“, wenn ein Kind den Tisch gedeckt hat, dauert keine Sekunde und ist schon eine ethisch begründete Handlungsweise.
Ein Rahmen, das wär‘s!
In einer Abschlussrunde stellte eine pädagogische Fachkraft fest: „Wir haben so viele Fortbildungen, so viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen: Adultismus, Partizipation, Demokratie, Sprachbildung, Medien. Ich finde das ja alles auch wichtig, aber ich war so verwirrt, wie das alles zusammenpassen soll. Ich habe gedacht, es ist immer noch etwas Neues. Mit den Reckahner Reflexionen habe ich das Gefühl, dass dem Ganzen ein Rahmen gegeben wurde. Jetzt passt alles zusammen.“
Die pädagogische Fachkraft beschreibt die Reckahner Reflexionen als Rahmen für verschiedene Konzepte, Themen und Herausforderungen, die an die Kita gestellt werden. Die Reckahner Reflexionen stellen all diese für sie in einen plausiblen Zusammenhang und können so als haltgebene Richtschnur verstanden werden.
Die Reckahner Reflexionen als Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte
Die von der pädagogischen Fachkraft benannten Themen sind komplex und anspruchsvoll, wenn sie im Kita-Alltag umgesetzt werden. Viele Fachkräfte, die in meinen Fortbildungen sind, fühlen sich herausgefordert, wenn sie von Adultismus hören oder wenn der Kita-Träger entscheidet, dass die Partizipation der Kinder gefördert werden soll. Die Reckahner Reflexionen erscheinen dagegen durch ihre Komprimierung auf 10 Leitlinien einfach und greifbar. Die Leitlinien sind grundsätzlich konsensfähig, das heißt, sie wurden so geschrieben, dass man ihnen zustimmen kann. Sie haben nicht das Ziel, Widerstand hervorzurufen. In der Praxis scheint dies zu gelingen: Zwar sehen pädagogische Fachkräfte einzelne Leitlinien als leicht oder schwer umsetzbar an, jedoch stimmen sie der Erwünschtheit der Leitlinien zu, in der Regel ohne in ein utopisches Denken abzudriften nach dem Motto, schön wäre es, aber das ist nicht realistisch. Vielmehr halten sie die Leitlinien für erstrebenswert und sehen sich grundsätzlich in der Lage, danach zu handeln. Dadurch können sie als Reflexionsgrundlage dienen und Weiterentwicklung anstoßen. Denn all diese Themen, die die Fachkräfte als herausfordernd erleben, regen zur Reflexion über die eigene Haltung in Bezug auf verschiedene Facetten der Reckahner Reflexionen an.
Die Umsetzung der Reckahner Reflexionen als Herausforderung an die eigene Haltung
Die Leitlinien können je nach individueller Haltung und Entwicklung der Kita unterschiedlich ausgelegt werden. So ist beispielsweise Leitlinie 7 „Es ist nicht zulässig, dass Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche diskriminierend […] behandeln“ konsensfähig. Dennoch kommt es zu diskriminierenden Handlungsweisen in Kitas, zum Beispiel wenn es nur Puppen mit weißer Hautfarbe gibt. Wenn die Fachkräfte nicht aus rassistischer Absicht handeln, ist es wahrscheinlich, dass auch sie Leitlinie 7 zustimmen würden. Es ist daher wichtig, dass pädagogische Fachkräfte in Bezug auf Diskriminierung sensibilisiert werden. Je sensibilisierter eine Fachkraft ist, desto eher wird sie Diskriminierung wahrnehmen. Der Schluss liegt nahe, dass sie dann auch das Umsetzen von Leitlinie 7 schwieriger findet.
Viele Themen, die an die Kitas als „neu“ herangetragen werden – Adultismus, Demokratiepädagogik, Partizipation, Bedürfnisorientierung in der Kita, achtsame Sprache, Gewaltfreie Kommunikation u.v.m. können die Reckahner Reflexionen nutzen, um nicht als zusätzlicher Faktor, sondern um als Vertiefung einer konsensfähigen Haltung gesehen zu werden. Das kann Widerstand mindern, indem sich pädagogische Fachkräfte in ihrer Haltung bestärkt sehen.
Die Reckahner Reflexionen als Richtschnur für neue Konzepte
Eine andere Möglichkeit ist es, die Reckahner Reflexionen zu nutzen, um Themen und Konzepte, die an Kitas herangetragen werden, dahingehend zu prüfen, ob sie es erleichtern oder erschweren, anerkennende Beziehungen zu gestalten.
Eine Herausforderung, mit der sich viele pädagogische Fachkräfte konfrontiert sehen, sind Verhaltensweisen von Kindern, die sie herausfordern. Dazu gehören Regelverletzungen. Eine häufige Methode, damit umzugehen sind Strafen und Ermahnungen, oder moderner: Ampel-, Belohnungs- und Tokensysteme. Hehn-Oldiges und Ostermann (2020) analysierten solche Systeme anhand der Reckahner Reflexionen: Solche Systeme erschweren es, anerkennende Beziehungen zu gestalten, indem sie die Suche nach dem subjektiven Grund des Verhaltens (Leitlinie 5) obsolet werden lassen und darüber hinaus demütigend, entmutigend, herabsetzend und ausgrenzend wirken können.
Eine Kernaufgabe pädagogischer Fachkräfte in Kitas ist es, die Entwicklung von Kindern zu beobachten und zu dokumentieren. Dafür stehen zahlreiche unterschiedliche Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente zur Verfügung. Nur wenige davon sind verbindlich, meistens obliegt es dem Träger oder der Kita, sich für ein Instrument zu entscheiden. Die Reckahner Reflexionen können eine Richtschnur sein, um aus der Vielzahl an Instrumenten auszuwählen: Welches Instrument ist wertschätzend? Mit welchem werden gelingende Verhaltensweisen und Lernfortschritte erfasst und besprechbar gemacht? Welche fördern die Kommunikation über weitere Schritte mit Kindern, Eltern und im Team? Welche Instrumente bestärken Kinder in ihrer Entwicklung (Leitlinien 3 und 4)?
Fazit
So können sich die Leitlinien und andere Konzepte gegenseitig stützen und befruchten: Die Reckahner Reflexionen bilden eine konsensfähige Basis zur Gestaltung pädagogischer Beziehungen. Weitere Konzepte vertiefen einerseits die in den Reckahner Reflexionen festgehaltenen Grundgedanken. Andererseits können unterschiedliche Konzepte und Methoden daran gemessen werden, ob sie es erleichtern, anerkennende Beziehungen zu gestalten.
Mit den Reckahner Reflexionen können sich pädagogische Fachkräfte so immer wieder auf das Wesentliche besinnen und verschiedene Konzepte und Fortbildungsthemen in einen Zusammenhang stellen: Die Gestaltung anerkennender pädagogischer Beziehungen.
Bezug zu Annedore Prengel:
Ich bin Dr. Jennifer Lambrecht und im Netzwerk zu den Reckahner Reflexionen aktiv. Ich gebe Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Teams zu den Themen pädagogische Beziehung, Kinderschutz und Qualitätsentwicklung. Hier liegen auch meine Forschungsinteressen, denen ich in unterschiedlichen Kontexten nachgehe – zuletzt bei KiTeAro, Institut für Bildung, Forschung und Entwicklung in der Pädagogik. Ich habe Annedore Prengel an der Uni Potsdam kennengelernt. Sie hat mich nach Reckahn zu einer Konferenz eingeladen – ich bin immer wieder gekommen und seitdem sind pädagogische Beziehungen mein Herzensthema. Durch Annedore und Reckahn weiß ich stets, was in der Pädagogik wirklich wichtig ist. Wenn sich meine Gedanken manchmal überschlagen, finde ich in Reckahn und den Reckahner Reflexionen eine sichere Basis. Danke, Annedore!
Literatur
Deutscher Kitaleitungskongress (DKLK) (2023). DKLK-Studie 2023 Themenschwerpunkt: Personalmangel in Kitas im Fokus. https://deutscher-kitaleitungskongress.de/wp-content/uploads/2023/03/DKLK_Studie_2023_210x297_A4_V07_RZ-1.pdf
Gambaro, L., Spieß, K., Westermaier, F. (2021). Erzieherinnen empfinden vielfache Belastungen und wenig Anerkennung. DIW Wochenbericht 19/2021 (S. 323-332), https://www.diw.de/de/diw_01.c.817992.de/publikationen/wochenberichte/2021_19_1/erzieherinnen_empfinden_vielfache_belastungen_und_wenig_anerkennung.html
Hehn-Oldiges, M. & Ostermann, B. (2020). Ampeln und andere Ermahnungssysteme – problematische Strategien zur Erziehung. Blogbeitrag auf Pädagogische-Beziehungen, https://paedagogische-beziehungen.eu/ampeln-und-andere-ermahnungssysteme-problematische-strategien-zur-erziehung/
Hildebrandt, F., Walter-Laager, C., Flöter, M., Pergande, B. (2021). Abschlussbericht zur Studie. BiKA Beteiligung von Kindern im Kita-Alltag. Fachhochschule Potsdam/Entwicklungsinstitut PädQUIS/An-Institut an der Alice Salomon Hochschule/Kooperationsinstitut der Universität Graz. https://www.kompetenznetzwerk-deki.de/material/abschlussbericht-der-bika-beteiligung-im-kita-alltag-studie.html
Köller, O., Anders, Y., Becker-Mrotzek, M., Dreyer, R., Maaz, K., Prediger, S., Thiel, F. (2020). Qualitätskommission zur Schulqualität in Berlin. Empfehlungen zur Steigerung der Qualität von Bildung und Unterricht in Berlin. Abschlussbericht der Expertenkommission. https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/abschlussbericht_expertenkommission_6-10-2020.pdf
Pianta, R. C. (2014). Children cannot be successful in the classroom unless they are successful in relationships – Analysen und Interventionen zur Verbesserung von Lehrer-Schüler-Beziehungen. In A. Prengel & U. Winklhofer (Hrsg.): Kinderrechte in Pädagogischen Beziehungen. Band 2: Forschungszugänge (S. 127-141). Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Verlag.
Prengel, A. (2020). Ethische Pädagogik in Kitas und Schulen. (Pädagogik, 1. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
Tellisch/Prengel (2019). Pädagogische Beziehungen im Kindergarten – Wie inklusive Prozesse gestärkt und geschwächt werden. NIFBE (Hg.) Inklusive Haltung und Beziehungsgestaltung. Kompetenter Umgang mit Vielfalt in der Kita. Freiburg u.a.: Herder-Verlag.