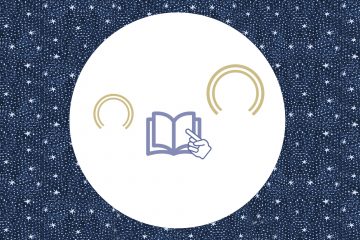Kinder ohne Rechte? – Problemlagen, biographische Erfahrungen und Bedarfe
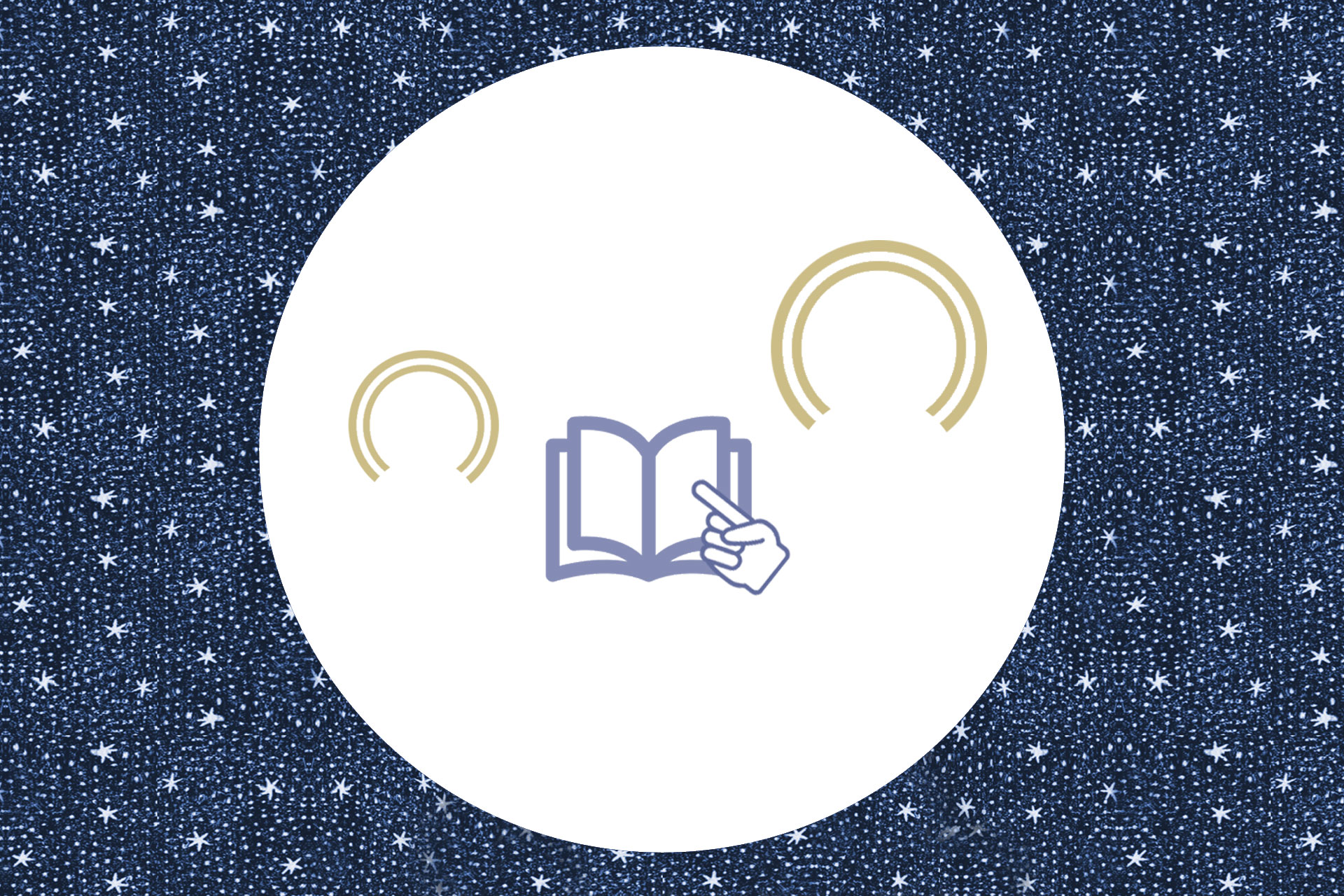
(von Sophia Richter & Barbara Friebertshäuser, Mai 2025)
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
Kinder ohne Rechte? Diese Frage erscheint als Provokation – so haben Kinder Rechte – spätestens seit den UN-Kinderrechtskonventionen (1989). Dort heißt es u.a.: „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ (Artikel 3 Abs 1 UN KRK)
Zugleich kann man fragen, wie diese Rechte umgesetzt und gelebt werden, wer von den Rechten weiß, sie einfordert oder ignoriert. Für Kinderrechte kämpft Annedore Prengel seit Jahrzehnten. Davon zeugen ihre zahlreichen Vorträge und Publikationen, die einen weiten Bogen spannen von der „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel, 1993) bis zu Bänden im Anschluss an Tagungen, die das Thema facettenreich behandeln (Prengel & Winklhofer, 2014). Zentral ist für sie dabei auch die Frage, welche Bedeutung der Anerkennung und Akzeptanz des Anderen in pädagogischen Beziehungen sowie öffentlichen Erziehung zukommt (Prengel, 2019). Die Reckahner Reflexionen bilden dafür den von ihr geschaffenen Rahmen und ein Forum der steten Diskussion und Weiterentwicklung einer Ethik in der Pädagogik, die sich an den Rechten von Kindern orientiert.
Gefragt wird in diesem Beitrag danach, was in der Debatte um Kinderrechte verhandelt wird und um welche Problemlagen es sich handelt. Dazu analysieren wir die gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland und suchen nach Ansätzen und Möglichkeiten für eine stärkere Implementierung der Kinderrechte in pädagogischen Praxisfeldern.
Initiative Kinderrechte ins Grundgesetz – ohne Chancen?
Der Einsatz für Kinderrechte und die gesetzliche Verankerung von Kinderrechten, kann auf Beiträge verweisen, die fast 100 Jahre zurück liegen. Insbesondere Janusz Korczak hat sehr früh für das Recht des Kindes auf Achtung geworben und dieses in seiner Pädagogik praktisch umgesetzt (Korczak, 1928/29; Wyrobnik, 2024). Die UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland seit 1992 gilt und das „Recht auf gewaltfreie Erziehung“, das in Deutschland im Jahr 2000 verabschiedet wurde, sind zentrale Bezugspunkte dieser Auseinandersetzungen. Deutschland hat sich mit der Ratifizierung verpflichtet, die Rechte von Kindern zu achten, zu schützen und zu fördern. Dazu gehört auch, Kinder über ihre Rechte aufzuklären. Allerdings wurden bisher die Kinderrechte nicht ins Grundgesetz integriert und auch darüber hinaus werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen bei vielen wichtigen Entscheidungen von Politik, Verwaltung und Rechtsprechung bisher wenig berücksichtigt. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP aus dem Jahr 2021 hat man festgehalten: „Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention.“ (S. 77, vgl. https://www.lpb-bw.de/kinderrechte-im-gg). Es bleibt spannend zu verfolgen, wann diese Absichtserklärung auch umgesetzt wird und ob eine Initiative, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen (trotz ihrer überzeugenden Begründungen), überhaupt eine Chance erhält, diese Forderung umzusetzen. Die Aktion von Carolin Kebekus in der ARD zum Thema „Kinder stören“ befasst sich mit diesem Problemfeld auf mediale Weise und zeigt, dass es viele mögliche Formate gibt, um die Öffentlichkeit aufzurütteln.
Ausgangspunkte und Problemanalysen
Seit 1994 setzt sich das Aktionsbündnis Kinderrechte – Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund, UNICEF Deutschland – für die vollständige Umsetzung der Kinderrechte ein. In Kooperation mit der deutschen Liga für das Kind fordern sie, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Im Grundsatzpapier heißt es dazu: „Trotz wichtiger Reformen in der Vergangenheit kommt es immer wieder zu Gefährdungen durch Vernachlässigung oder Gewalt, sei es durch Überforderung der Eltern, durch eine Täterschaft anderer Privatpersonen oder durch Defizite in öffentlichen Institutionen. Eine Verankerung des Rechtes der Kinder auf Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung im Grundgesetz würde den Kinderschutz und das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung stärken. Das Wohlergehen der Kinder ist häufig schon lange in Gefahr, bevor es zu unmittelbarer Gewalt oder extremen Formen der Vernachlässigung kommt. Hier würde eine Grundgesetzänderung Entscheidungsträger bei der Interessenabwägung im Sinne des Kindeswohls stärken.“ (Aktionsbündnis Kinderrechte, 2011, S. 5)
Von Gefährdungen durch Vernachlässigung oder Gewalt ist hier die Rede, aber auch von Täterschaft von Privatpersonen oder Defiziten in öffentlichen Institutionen. UNICEF Deutschland macht auf ihrer Homepage darauf aufmerksam, dass Gewalt gegen Kinder viele Gesichter hat. Anders als vielfach angenommen, wird sie häufig gerade durch diejenigen ausgeübt, die den Kindern am nächsten sind: ihre Eltern, Erziehende oder andere Bezugspersonen. Und sie führen dazu auch Beispiele an: wie Schläge, eine Ohrfeige oder regelmäßige Demütigungen durch Sätze wie „Du schaffst das sowieso nicht“ oder auch das Unterlassen essenzieller Handlungen wie die körperliche und emotionale Sorge. Annedore Prengel führt auf Basis einer groß angelegten Beobachtungsstudie von anerkennendem und verletzendem sowie ambivalentem Verhalten innerhalb pädagogischer Beziehungen von Lehrkräften und Schüler:innen folgende Formen von Gewalt auf: „Fehler oder Fehlverhalten, diskriminieren, kritisieren, Kinder anbrüllen, sarkastisch ansprechen, lächerlich machen, beschämen, ignorieren, […] Schülerinnen und Schüler nicht anhören, […] Kummer und körperliche Schmerzen ignorieren, bei Fehlverhalten keine Grenzen setzen“ (Prengel, 2019, S.115). Ähnliche Differenzierungen von Gewaltmustern finden sich auch bei Volker Krumm und Susanne Weiß (2001).
Grundlegend wird in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von Gewalt zwischen körperlicher, sexualisierter Gewalt, psychischer bzw. seelischer Gewalt und Vernachlässigung unterschieden, wobei sich diese Formen nicht klar voneinander trennen lassen und häufig gemeinsam auftreten. Dabei spielt es für das Gewalterleben kaum eine Rolle, ob das Handeln von Seiten der Erwachsenen intentional oder ungewollt ist. Zu den Dimensionen von Gewalt in ihren relationalen Verschränkungen liegen bisher noch zu wenig Forschungen vor. Auch zu dem Erleben von Gewalt, der Gewaltausübung sowie den damit verbundenen Folgen, bedarf es weiterer Forschungen. Das seit 2024 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Netzwerk „Dimensionen seelischer Gewalt in pädagogischen Settings. Theoretische Bestimmungen und empirische Analysen“ widmet sich diesem Desiderat.
Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – einige Fakten
Es ist schwierig, das tatsächliche Ausmaß von Gewalt gegen Kinder zu erfassen. Da nur ein kleiner Teil der Taten angezeigt oder in den Versorgungssystemen dokumentiert wird, werden sehr viele Taten statistisch nicht erfasst und bleiben deshalb im Dunkelfeld. Insbesondere Formen seelischer Gewalt bleiben zumeist im Dunkeln. Dazu gehören psychische Misshandlungen: Erniedrigungen durch Worte, Diskriminierung, Anschreien, Liebesentzug bis hin zu Bedrohungen und offener Verachtung. Zum Feld der Vernachlässigung gehört das Versagen, einem Kind grundlegende körperliche und emotionale Bedürfnisse im Bereich der Gesundheit, Bildung, emotionalen Entwicklung, Ernährung, Unterbringung und nach einem sicheren Lebensumfeld zu erfüllen. (Quelle UNICEF: https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/gewalt-gegen-kinder-beenden/was-ist-gewalt-fragen-und-antworten)
Annedore Prengel hat in ihren Beiträgen vielfach auf dieses Problem aufmerksam gemacht und fordert eine Pädagogikethik, um gerade im schulischen und außerschulischen pädagogischen Feld dafür zu sensibilisieren (https://paedagogische-beziehungen.eu/paedagogische-ethik-eine-antwort-auf-seelische-verletzungen/). Die qualitative Beobachtungsstudie INTAKT (Soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern) gibt Einblicke in Gewaltdimensionen innerhalb pädagogischer Beziehungen. Den Befunden zufolge sind vermutlich ein Viertel der Interaktionen von Lehr- und Fachkräften mit Kindern und Jugendlichen in Kitas und Schulen als verletzend zu charakterisieren (Prengel, 2019). Zugleich sind seelische Verletzungen die am meisten ignorierte Form der Gewalt, die Kinder und Jugendliche in pädagogischen Einrichtungen und Schulen erleiden – während Körperstrafen und sexualisierte Gewalt öffentlich beachtet und juristisch geahndet werden. Vor diesem Hintergrund hat sie das Vorhaben der „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“ ins Leben gerufen.
Zu Formen sexualisierter Gewalt in Deutschland liegen nur wenige konkrete Zahlen vor, da das Dunkelfeld vermutlich sehr groß ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass bis zu eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder gegenwärtig erfahren. Präzise Angaben zur Häufigkeit von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht möglich. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) gibt nur Aufschluss über die Fälle, die polizeilich angezeigt und strafrechtlich verfolgt werden […]. Für das Jahr 2022 verzeichnet die PKS: 15.520 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Viele Fälle gehen jedoch nicht in die Kriminalstatistik ein, weil sie nie zur Anzeige gebracht werden. Die Zahlen in der Kriminalstatistik steigen seit einigen Jahren stetig an, was jedoch auch auf eine Zunahme der Anzeigebereitschaft zurückgehen kann.
Problemfeld sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
Anknüpfend an diese Befunde wäre zu fragen, ob Pädagog:innen ausreichend auf dieses Themenfeld vorbereitet sind. Wenn man davon ausgehen kann, dass sich in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder finden, die sexualisierte Gewalt in irgendeiner Form und in verschiedenen Kontexten erlitten haben oder gegenwärtig noch erleiden, dann besteht ebenso dringender Handlungsbedarf wie angesichts der Tatsache, dass Kinder auch im Kontext der öffentlichen Erziehung Gewalt ausgesetzt sind.
„Gewalterfahrungen gehen mit vielfaltigen Risiken für die körperliche Gesundheit und die seelische Entwicklung einher; die höchsten psychosozialen Belastungen tragen dabei Kinder und Jugendliche, die sowohl Gewalt ausüben als auch erleiden“ (Robert-Koch-Institut [RKI] & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA], 2008, S. 27) Als besonders vulnerabel gelten Gesamt- und Hauptschüler:innen, Jungen, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Als Schutzfaktoren werden Selbstwertgefühl, die aktive Bewältigung von Problemen sowie eine Unterstützung durch Gleichaltrige und Erwachsene genannt (vgl. Robert-Koch-Institut, 2008, S. 27).
Es stellt sich die Frage, wie ein pädagogisches Umfeld geschaffen werden kann, damit Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen und anvertrauen, über das Erlebte berichten und in der Bewältigung des Geschehenen begleitet und unterstützt werden. Das pädagogische und erziehungswissenschaftliche Feld stellt sich seit einigen Jahren dieser Problematik, die jahrzehntelang weitgehend verdeckt und verborgen geblieben ist. Gewalt und Grenzüberschreitungen gegen Kinder und Jugendliche in der Familie, aber auch in öffentlichen und pädagogischen Institutionen (z.B. der Odenwaldschule oder dem Canisius-Kolleg, aber auch in der Heimerziehung oder auf Freizeiten sowie in Sportvereinen) fanden lange Zeit kein Gehör. Erst durch die Berichte Betroffener über Gewaltverhältnisse begann mit dem Jahr 2010 eine öffentliche Wahrnehmung und Auseinandersetzung (Andresen, 2020). Aktuell ist ein selbstkritischer Aufarbeitungsprozess in Gang gekommen, der auch den Ausgangspunkt für eine erziehungswissenschaftlich orientierte Gewaltforschung bietet (Andresen, 2021, S.124; Piezunka, 2023).
Sexualisierte Gewalt und seelisches Leid – eine wenig erschlossene Erfahrung
Was bedeuten Gewalterfahrungen – und insbesondere die Erfahrung sexualisierter Gewalt – für die psychische und physische Gesundheit? Welches seelische Leid verbirgt sich möglicherweise hinter den Zahlen. Wenn es um das Reden über Gewalt und sexualisierte Gewalt geht, dann zeigt sich, dass anonymisierte schriftliche Formate sehr nützlich sein können, um das Unsagbare zumindest zu Papier zu bringen und so schreibend zu verarbeiten. Davon zeugen auch die zahlreichen Dokumente, die der Aufarbeitungskommission von Betroffenen zur Verfügung gestellt wurden und die nun im Internet zugänglich sind (vgl. https://www.geschichten-die-zaehlen.de/). Dabei handelt es sich um Lebensgeschichten und Lebensausschnitte von Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben. Der Kommission liegen bereits über 700 schriftliche Berichte vor. Sie handeln von der Not und dem Leid der Betroffenen während des eigenen Aufwachsens, von Erfahrungen, über die sie oftmals mit niemandem reden konnten. Die Dokumente laden dazu ein, sich mit dem Unsagbaren und Verdrängten und dem seelischen Leid der Betroffenen auseinanderzusetzen. Denn nur so kann es gelingen, die Tabuisierungen, das Wegschauen und die damit verbundene schweigende Duldung zu durchbrechen und ins Handeln zu kommen. Bei der Auseinandersetzung mit Gewalt geht es auch um das Verhältnis von Sprechen und Schweigen (Andresen, 2020, S.109). Denn die Thematisierung der Gewalt stößt aufgrund von verbreiteter gesellschaftlicher Tabuisierung und Stigmatisierung schnell an die Grenzen des Denkbaren und Sagbaren. Das Problemfeld des Sprechens über sexuelle Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend wird erst in jüngster Zeit forschend zu durchdringen gesucht, bspw. Andrea Pohling (2021) hat dazu anregende biographieanalytische Analysen vorgelegt.
Deutlich wird in den vorliegenden Studien, dass die Betroffenen keine Räume zum Sprechen finden oder kein Gehör. Hier wäre anzusetzen, damit die Mauer aus Schweigen und Wegschauen durchbrochen wird und (möglichst auch gemeinsam mit den Betroffenen) danach geschaut wird, welche Unterstützung und Hilfen angemessen wären. Deutlich wird in den Berichten und Studien, wie sehr solche Erfahrungen und seelischen Verletzungen das Leben der Betroffenen – auch ihren Bildungs- und Ausbildungsweg – geprägt haben und auf das gesamte Leben ausstrahlen.
Tabuisierung, Wegschauen und Schweigen?
Was bedeuten diese Befunde für die Umsetzung von Kinderrechten? Bisher scheint es so, dass Kinder und Jugendliche zwar Rechte haben, aber keine Hilfen beim Einklagen und Umsetzen dieser grundlegenden Rechte erhalten. Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, das könnte helfen. Eine Enttabuisierung stellt zudem eine zentrale Voraussetzung dar, um zukünftig die Schweigsamkeit gegenüber sämtlichen Gewalterfahrungen zu überwinden, um Betroffenen – insbesondere Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden – Beistand, Schutz und Unterstützung zu gewähren, eine Aufarbeitung auszuweiten, Forschung auf diesem Feld zu fördern, Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und auch Entschädigungen zu veranlassen. Zugleich gilt es, Kinderrechte bekannter zu machen und gezielt umzusetzen. Pädagogische Einrichtungen sollten sich fragen, wie sich junge Menschen vor der Destruktivität oder Gewalt durch für sie verantwortliche Fachkräfte schützen lassen. Dazu gehört auch die Einrichtung von Kinderschutzkonzepten in allen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es bedarf Maßnahmen der Prävention und Intervention, um auf Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen in Familien oder Institutionen reagieren zu können (expl. Wolff, Schröder & Fegert, 2017; Böwer & Kotthaus, 2023).
Wie wären pädagogische Beziehungen zu verbessern, um fruchtbare Momente möglich zu machen und Entwicklung, Lernen und demokratische Sozialisation zu stärken? Wie können wir Kinder mit ihren Botschaften verstehen, genau hinschauen, hinhören, achtsam und aufmerksam sein für ihre Signale, zu hilfreichen Anderen werden, ihnen mit Wertschätzung und Anerkennung begegnen? Für alle diese Themen hat sich Annedore Prengel als Wissenschaftlerin und Person in vielfältiger Weise eingesetzt und Initiativen dazu unterstützt oder selbst ins Leben gerufen. Die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen sind ein wichtiger Beitrag auf diesem Weg.
Literaturverzeichnis:
Aktionsbündnis Kinderrechte (2011). Hintergrundpapier des „Aktionsbündnis Kinderrechte“. https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/wp-content/uploads/2017/11/Grundsatzpapier-Kinderrechte-ins-Grundgesetz-2011.pdf
Andresen, Sabine (2020). Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Impulse für die sozialwissenschaftliche Gewaltforschung. WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, 17(1), 103-114.
Andresen, Sabine (2021). Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Perspektiven auf eine erziehungswissenschaftlich orientierte Gewaltforschung. In Henrike Terhart, Sandra Hofhues & Elke Kleinau (Hrsg.), Optimierung. Anschlüsse an den 27. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Schriften der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)), S. 123–141). Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/84742485
Böwer, Michael & Kotthaus, Jochem (2023). Praxisbuch Kinderschutz: Professionelle Herausforderungen bewältigen (2. Aufl.). Beltz Juventa.
Korczak, Janusz (1994). Das Recht des Kindes auf Achtung (5 Aufl.). Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht (Polen 1928/29)
Krumm, Volker &Weiß, Susanne (2001). Machtmissbrauch von Lehrern in Österreich. Erweiterte Fassung eines Vortrag auf der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen. http://a-ch-d.eu/MATERIALIEN/hoeflichkeit/machtmissbrauchvonlehrerninoesterreich2002.pdf
Piezunka, Anne (2023). Seelische Verletzungen in der Gestaltung pädagogischer Beziehungen. In: Nico Leonhardt, Anne Goldbach, Lucia Staib & Saskia Schuppener (Hrsg.), Macht in der Schule. Wissen – Sichtweisen – Erfahrungen. Texte in Leichter Sprache, Einfacher Sprache und Fachsprache (S. 218-230). Verlag Julius Klinkhardt. https://doi.org/10.25656/01:26148
Pohling, Andrea (2021). Artikulationen sexueller Gewalt. Sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend: Forschung als Beitrag zur Aufarbeitung. Springer VS, Wiesbaden.
Prengel, Annedore & Winklhofer Ursula (2014). Kinderrechte in Pädagogischen Beziehungen. Band 1: Praxiszugänge; Band 2: Forschungszugänge. Verlag Barbara Budrich
Prengel, Annedore (1993). Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik (1. Aufl.). Leske und Burdrich.
Prengel, Annedore (2019). Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz (2. Aufl.). Verlag Barbara Budrich.
Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2008). Erkennen – Bewerten – Handeln: Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/Basiserhebung/KiGGS_GPA.pdf?__blob=publicationFile
Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (2019). Geschichten die zählen. Bilanzbericht 2019. Band I. https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2019/05/Bilanzbericht_2019_Band-I.pdf
Wolff, Mechthild, Schröer, Wolfgang & Fegert, Jörg M. (2017). Schutzkonzepte in Theorie und Praxis. Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch. Beltz Juventa.
Wyrobnik, Irit (2024). Partizipation durch Beschwerde(n) in der Pädagogik Janusz Korczaks – Theorie, Praxis, Aktualität. In Claudia Maier-Höfer, Urszula Markowska-Manista & Nektarios Stellakis (Hrsg.), Theorien und Praktiken der Selbstbestimmung und Partizipation: Janusz Korczak im Diskurs (Theories and practices of self-determination and participation : Janusz Korczak in discourse) (S. 135-143). Springer VS https://doi.org/10.1007/978-3-658-30764-6
Angaben zu den Autorinnen:
Barbara Friebertshäuser, Dr. phil., Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt/Main, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft, seit Oktober 2023 im Ruhestand, Schwerpunkte: Empirisch-pädagogische Geschlechterforschung, Qualitative Forschungsmethoden, Jugend- Schul- und Hochschulforschung sowie Übergangsforschung. Kontakt: b.friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de
Sophia Richter, Dr. phil. Professorin für Bildungswissenschaften an der Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Institut für Schulentwicklung, Fort- & Weiterbildung. Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte: Schulforschung, Hochschulforschung, Jugend- und Kulturforschung, qualitative Forschungsmethoden, insbesondere Ethnographie, forschendes Lernen, systemische Theorie und Praxis. Kontakt: sophia.richter@ph-vorarlberg.ac.at | https://www.ph-vorarlberg.ac.at/sophia-richter#c5429
Bezug zu Annedore:
Wir fühlen uns durch die langjährige Zusammenarbeit mit Annedore und ihr Schaffen inspiriert und bereichert. So wünschen wir ihr zum 80. Geburtstag die verdiente Würdigung sowie weiterhin viel Kraft und Gesundheit für ihr wertvolles Tun.