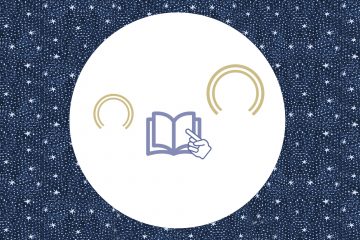Pädagogik der Anerkennung – ethisch begründet und theoretisch fundiert
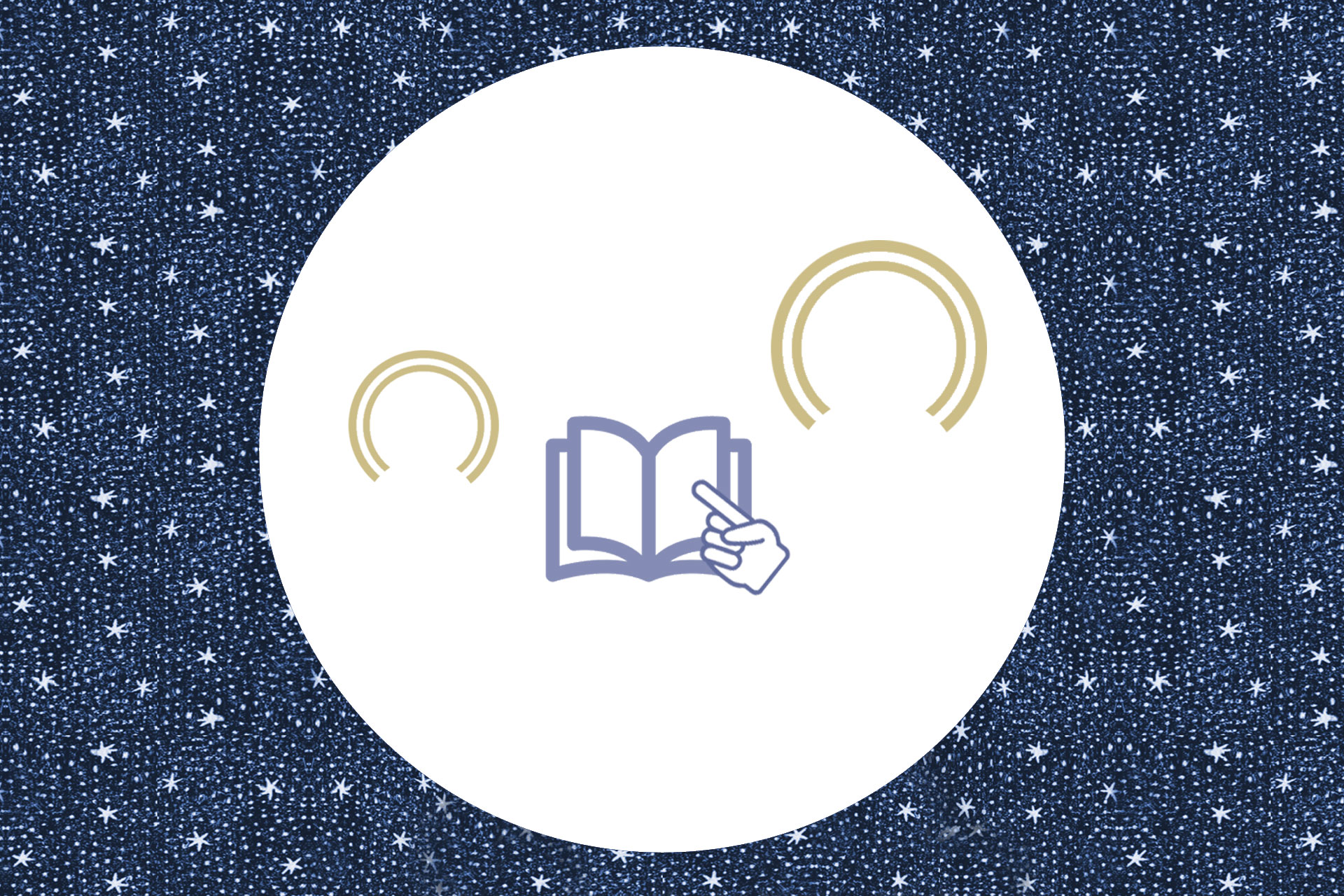
(von Britta Ostermann, Mai 2025)
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
Die Person Annedore Prengel ist unweigerlich mit den Begriffen Egalitäre Differenz, Pädagogik der Vielfalt, Pädagogische Beziehungen und Pädagogische Ethik verbunden. Denke ich an diese außergewöhnliche Erziehungswissenschaftlerin und Lehrerin, die heterogene Lerngruppen als bereichernd erlebt, kommt mir sofort ihr unermüdliches Forschen nach „genügend guten“ (Winnicott 1983) Bedingungen in Bezug auf Lernen und Entwicklung für alle Heranwachsenden an einem gemeinsamen Lernort in den Sinn.
Vor diesem Hintergrund versucht der Beitrag zum einen die genannten Begriffe zusammenzudenken und darzustellen, dass die theoretischen und empirischen Studien von Annedore Prengel auf eine Pädagogik der Anerkennung zurückzuführen sind, die ethisch begründet sowie theoretisch fundiert ist und zugleich Handlungsempfehlungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte auf fünf Ebenen ermöglicht. Zum anderen wird mit diesem Artikel intendiert sowohl das Lebenswerk von Annedore Prengel als auch ihre Verdienste für gelingende Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse von Kindern und Jugendlichen zu würdigen.
Jedes Kind ist gleich und verschieden!
Mit Inklusion ist international das Ziel verbunden, allen Kindern eine angemessene Grundbildung an einem wohnortnahen, gemeinsamen Ort zu ermöglichen (vgl. Prengel 2015, S.27). Das Modell des gemeinsamen Lernens in heterogenen Lerngruppen, das zunächst als integrative Erziehung und Bildung verwirklicht wurde, wird in Deutschland bereits seit nahezu fünfzig Jahren an zahlreichen Schulen entwickelt, erprobt sowie umfassend wissenschaftlich untersucht (vgl. zusammenfassend Müller/Prengel 2013). Auch Annedore Prengel hat mit ihren Studien gezeigt, dass gemeinsames Lehren und Lernen in einer Schule für alle gelingen kann (vgl. Müller/Prengel 2013). Grundlage hierfür ist, dass pädagogische Fach- und Lehrkräfte jedes Kind als gleich und verschieden wahrnehmen und anerkennen: Es ist gleich hinsichtlich seiner Rechte (u.a. Recht auf Bildung) und Grundbedürfnisse (u.a. nach ausreichender Nahrung, feinfühliger Bindung an eine verlässliche erwachsene Bezugsperson) sowie verschieden hinsichtlich seines Alters, seiner Geschlechtszugehörigkeit, seines sozio-ökonomischen Status, seiner ethnisch-kulturellen Herkunft, seiner Fähigkeiten und Interessen. In ihrer Habilitationsschrift hat Annedore Prengel die Erkenntnisse drei pädagogischer Arbeitsfelder (Interkultureller Pädagogik, Feministischer Pädagogik und Integrativer Pädagogik) zusammenfließen lassen. Die auf diese Weise gewonnenen heterogenitätstheoretischen Einsichten hat sie schließlich im Hinblick auf Schulbildung konkretisiert und thesenartig als siebzehn Elemente einer Pädagogik der Vielfalt dargestellt (vgl. ausführlich Prengel 2006, S.184-196). Sie basieren auf den drei Dimensionen von Anerkennung (Liebe, Recht, Solidarität) nach Axel Honneth (1992) und bieten hilfreiche Anregungen für pädagogischen Handelns in inklusiven Lehr-Lernsettings (vgl. Prengel 2006, S.184-196).
Pädagogik der Vielfalt = Pädagogik der Anerkennung
Eine wegweisende Studie über Anerkennung unter bildungstheoretischen Fragestellungen legte Annedore Prengel im Jahr 1993 mit ihrer Konzeption einer Pädagogik der Vielfalt vor, die sich „als Pädagogik der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen“ (Prengel 2006, S.62) versteht. „Indem sie [die Pädagogik der Vielfalt] Missachtung im Bildungswesen zu vermeiden sucht, fördert sie persönliche Bildungsprozesse, sowie Qualifikations- und Sozialisationsprozesse und wirkt den schädlichen Folgen des im Bildungssystem vorherrschenden Selektionsprinzips entgegen“ (Prengel 2006, S.62).

Prengel entwirft mit dem Begriff der Egalitären Differenz ein Modell, das die dritte Honneth’sche Anerkennungsform der sozialen Wertschätzung bzw. Solidarität neu interpretiert (vgl. Micus-Loos 2012, S.310), indem Differenzen produktiv werden und es Schüler*innen in ihren jeweiligen Unterschieden zu ihrem Recht kommen lässt: „Egalitäre Differenz ist die grundlegende […] Idee der Pädagogik der Vielfalt, die ein nichthierarchisches, freiheitliches und entwicklungsoffenes Miteinander der Verschiedenen anstrebt“ (Prengel 2001, S.96). Im Spannungsfeld von Selbstachtung und Anerkennung der Anderen, eines von siebzehn Elementen einer Pädagogik der Vielfalt, sollen sich alternative Handlungsperspektiven eröffnen, die den Umgang mit Fremden erleichtern (vgl. Borst 2003, S.101). Demnach zeichnet Anerkennung sowohl von Gleichheit als auch von Differenzen eine Pädagogik der Vielfalt aus. Prengels Studie kann für den erziehungswissenschaftlichen Anerkennungsdiskurs als exemplarisch erachtet werden, da in ihr durchgängig der ethische Kern von Anerkennung betont und Anerkennung als ethische Norm und moralisches Prinzip pädagogischen Handelns herausgestellt wird (vgl. Balzer 2014, S.8). Die Pädagogik der Anerkennung von Vielfalt und Differenz sei der „Vision der Gerechtigkeit verpflichtet und […] ethisch motiviert“ (Prengel 2006, S.49), da intersubjektive Anerkennung jeder einzelnen Person in seiner einmaligen Lebenslage das „gesellschaftlich wertvolle Gut, das Schulen und andere pädagogische Einrichtungen aus eigener Machtbefugnis und eigenen Ressourcen zu verteilen haben“ (Prengel 2006, S.61) sei.
Kinder und Jugendlichen brauchen Anerkennung, um gut lernen und sich entwickeln zu können!
Ihre Untersuchungen zur Pädagogik der Vielfalt führt Prengel mit ihren theoretischen und empirischen Studien zur Qualität pädagogischer Beziehungen fort, dabei fokussiert sie weiterhin das Theorem der Anerkennung. Im erziehungswissenschaftlichen Diskurs sind – holzschnittartig zusammengefasst – zwei unterschiedliche Lesarten des Anerkennungsbegriffs zu finden: Zum einen wird Anerkennung als ein normatives sowie ethisches Prinzip pädagogischen Handelns und gleichzeitiges Qualitätsmerkmal pädagogischer Beziehungen verstanden. Zum anderen wird der Machtcharakter von Anerkennung herausgearbeitet und problematisiert (vgl. Balzer 2021, S.346). Annedore Prengel bezieht sich in ihren Studien auf die erste Lesart des Begriffs (vgl. Prengel 2013).
In ihren Schriften zu pädagogischer Beziehung wird eine wesentliche Dimension der Pädagogik der Vielfalt, die Solidarität, auf der Beziehungsebene vertieft und weitergeführt. In ihrer Beobachtungsstudie INTAKT (Soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern) konnte in fast 20-jähriger Kooperation ein nahezu 18.000 Feldvignetten umfassender Datensatz gesammelt werden, der aus einzelnen protokollierten Interaktionsszenen besteht, die in Schulen, Kindertagestätten und sozialpädagogischen Einrichtungen aufgezeichnet wurden. Insgesamt zeigen die Analysen der Feldvignetten, dass durchschnittlich etwa drei Viertel der beobachteten Interaktionen zwischen Pädagog*innen und Heranwachsenden anerkennend und neutral ausfallen, während ungefähr ein Viertel als verletzend und ambivalent eingestuft werden, wobei davon nahezu 6% der Interaktionen von den Beobachter*innen als starke Verletzungen kategorisiert werden (vgl. Prengel/Tellisch/Wohne/Zapf 2016, S.153). Dabei gilt für das Verständnis der genannten Befunde zu berücksichtigen, dass die Durchschnittswerte nichts über das Handeln Einzelner aussagen (vgl. Prengel 2013).
Die Forschungsergebnisse betrachtend lässt sich begründet annehmen, dass viele pädagogische Fach- und Lehrkräfte täglich im Sinne von Winnicott „genügend gute“ pädagogische Beziehungen realisieren. Sie zeigen, dass es im Bildungssystem möglich ist, die Lernenden respektvoll und anerkennend anzusprechen. Zugleich erfahren Kinder und Jugendliche auf allen Bildungsstufen mangelnde Anerkennung sowie Verletzungen durch Erwachsene, die sie betreuen und unterrichten (vgl. Prengel 2013, S.121). Dies kann fatale Auswirkungen auf ihre Entwicklung haben, denn falls lebenswichtige positive Beziehungserfahrungen mit „signifikant Anderen“ (Mead 1934) in frühen Jahren nicht ausreichend gemacht werden und Heranwachsende im Laufe ihrer Bildungsbiographie weiterhin Ablehnung erfahren und auf diese Weise kumulierende Anerkennungsmängel entstehen, seien laut Erziehungswissenschaftler Hans Oswald (2008) langfristig Schulverdrossenheit, Schulabsentismus und der Versuch endlich Anerkennung durch Anschluss an gewaltbereite Gruppen (Anerkennung durch Gewalt) zu finden, als Ausweg vorgezeichnet (vgl. Ostermann/Prengel 2019, S.36f.). Somit kann Anerkennung als notwendige Bedingung sowohl für die Entwicklung von Identität, Autonomie und Bildung als auch für Integration, Partizipation und Verantwortung verstanden werden (vgl. Ricken/Rose 2023, S.7).
Vor diesem Hintergrund fordert Prengel (2013) Pädagog*innen auf, sich verstärkt um positive Beziehungen zu allen Kindern und Jugendlichen zu bemühen, indem sie Anerkennung durch Solidarität mit Fremden, Solidarisches Engagement bei Erziehungsschwierigkeiten und Wertschätzen von Leistungen sichtbar machen und auf negative Zuschreibungen jedweder Art verzichten (vgl. Prengel 2013, S.61-74). Die Haltung der Pädagog*innen sollte dabei durch eine intersubjektive Anerkennung jedes Heranwachsenden als einzigartige Persönlichkeit geprägt sein. Sie besagt, dass jedes Kind subjektiv sinnvoll handelt und auf seiner Stufe der Entwicklung kompetent ist. Sie beschreibt den pädagogischen Verzicht auf solidarische Anerkennung, einschließlich solidarischer Grenzsetzung, insbesondere von Heranwachsenden, die als besonders herausfordernd erlebt werden, als einen professionellen Kunstfehler mit gravierenden Folgen (vgl. Prengel 2013, S.81).
Initiiert von Annedore Prengel hat der interdisziplinäre Arbeitskreis „Menschenrechtsbildung“ der Rochow-Akademie die „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“ erarbeitet. Sie haben die Stärkung anerkennender und die Verminderung verletzender Handlungsweisen in schulischen und außerschulischen Arbeitsfeldern zum Ziel. Das Vorhaben stellt somit einen Beitrag zu Antidiskriminierung und Inklusion auf der Beziehungsebene dar (vgl. Ostermann/Prengel 2019).
Bausteine inklusiver pädagogischer Praxis
Basierend auf den Erkenntnissen ihrer Studie sowohl zur Pädagogik der Vielfalt als auch zur Qualität pädagogischen Beziehungen hat Prengel zwölf Bausteine inklusiver pädagogischer Praxis herausgearbeitet, die Schulen bei der inklusiven Schulentwicklung unterstützen und zugleich von den Erkenntnissen einer Pädagogischen Ethik geleitet sind (vgl. Prengel 2022).
Diese Erkenntnisse hat Annedore Prengel in ihren zahlreichen Schriften dargelegt, in der universitären Lehrer*innenausbildung zukünftigen Lehrkräften vermittelt sowie in der Fort- und Weiterbildung an bereits in der pädagogischen Praxis tätige Lehrkräfte weitergegeben. Auf diese Weise hat sie über Jahrzehnte hinweg Generationen von Pädagog*innen inspiriert, Lernende anerkennend anzusprechen und Leistungen zu ermöglichen.
Anmerkung:
Im Jahr 2011 habe ich gemeinsam mit Prof. Dieter Rüttimann (PH Zürich, Institut Unterstrass) den internationalen, berufsbegleitenden Weiterbildungsmaster „Inklusive Pädagogik und Kommunikation“ weiterentwickelt. Annedore Prengel war damals Mitglied einer Kommission, die den Studiengang begutachtet und akkreditiert hat. Die Leidenschaft für die Themen „Anerkennung“ und „Pädagogische Beziehung“ hat uns zusammengeführt, so dass wir uns seit unserer ersten Begegnung während der Akkreditierung verbunden fühlen und nahestehen.
Literaturverzeichnis
Balzer, N. (2014): Spuren der Anerkennung. Wiesbaden: VS Verlag.
Balzer, N. (2021): Anerkennung als erziehungswissenschaftliche Kategorie. In: Siep, L./Heikki Ikäheimo, H./Quante, M. (Hrsg.): Handbuch Anerkennung. Wiesbaden: Springer VS, S. 345–352.
Borst, E. (2003): Anerkennung der Anderen und das Problem des Unterschieds. Perspektiven einer kritischen Theorie der Bildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
Honneth, A. (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Mead, H.G. (1910/ 1968): The psychology of social consciousness implied in instruction. In: Mead, H.G.: Essays on his social philosophy, ed. By J.W. Peters. New York: Teachers College Press, S.35-41.
Micus-Loos, Ch. (2012): Anerkennung des Anderen als Herausforderung in Bildungsprozessen. In: Zeitschrift für Pädagogik 58, 3, S.302–320.
Müller, F. J./Prengel, A. (2013): Empirische Zugänge zu Inklusion in der Früh- und Grundschulpädagogik. In: Zeitschrift für Grundschulforschung 7. Jg., Heft 1. S. 7– 20.
Ostermann, B./Prengel, A. (2019):Die Ethik pädagogischer Beziehungen. Ein blinder Fleck im Kontext von Erziehung, Bildung und Hilfe. In: Hofmeister, Jasmin (Hrsg.): Kindheit – vergessen und vermessen. Münster. S.33–50.
Oswald, H. (2008): Helfen, Streiten, Sielen, Toben. Die Welt der Kinder einer Grundschulklasse. Opladen/Farmington Hills: Budrich.
Prengel, A. (2006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
Prengel, A. (2013): Inklusive Bildung in der Primarstufe. Eine wissenschaftliche Expertise des Grundschulverbandes. Frankfurt am Main.
Prengel, A. (2015): Inklusive Bildung: Grundlagen, Praxis, offene Fragen. In: Häcker, Th./ Walm, M. (Hrsg.): Inklusion als Entwicklung. Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S.27– 46.
Prengel, A. (2019): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. 4., um ein aktuelles Vorwort ergänzte Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
Prengel, A. (2020): Ethische Pädagogik in Kitas und Schulen. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
Prengel, A. (2022): Schulen inklusiv gestalten. Eine Einführung in Gründe und Handlungsmöglichkeiten. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
Prengel, A./Tellisch, Ch./ Wohne, A./ Zapf, A. (2016): Lehr-Forschungsprojekte zur Qualität pädagogischer Beziehungen In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 2016, 34 (2), S.150–157.
Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Rochow- Edition: Reckahn 2017: http://www.rochow-museum.uni-potsdam.de/ reckahnerreflexionen.html (01.12.2017).
Ricken, N./Rose, N. (2023): Anerkennung und Adressierung. Theoretische Grundlagen und systematische Perspektiven. In: Ricken, N./Rose, N./Otzen, A.A./Kuhlmann, N. (Hrsg.): Die Sprachlichkeit der Anerkennung. Subjektivierungstheoretische Perspektiven auf eine Form des Pädagogischen. Weinheim: Beltz-Juventa, S. 20-67.
Tellisch, Ch. (2015): Lehrer-Schüler-Interaktionen im Musikunterricht als Beitrag zur Menschenrechtsbildung. Opladen/Berlin/Toronto: Budrich.
Winnicott, D. W. (1983/1958): Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse. Frankfurt a. M.: Fischer.