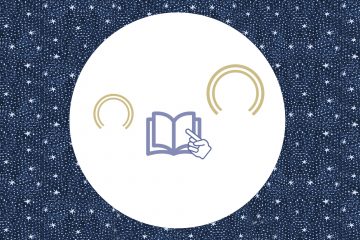Pädagogische Beziehungen und BNE – Herausforderungen in einer Welt der Krisen und Kriege
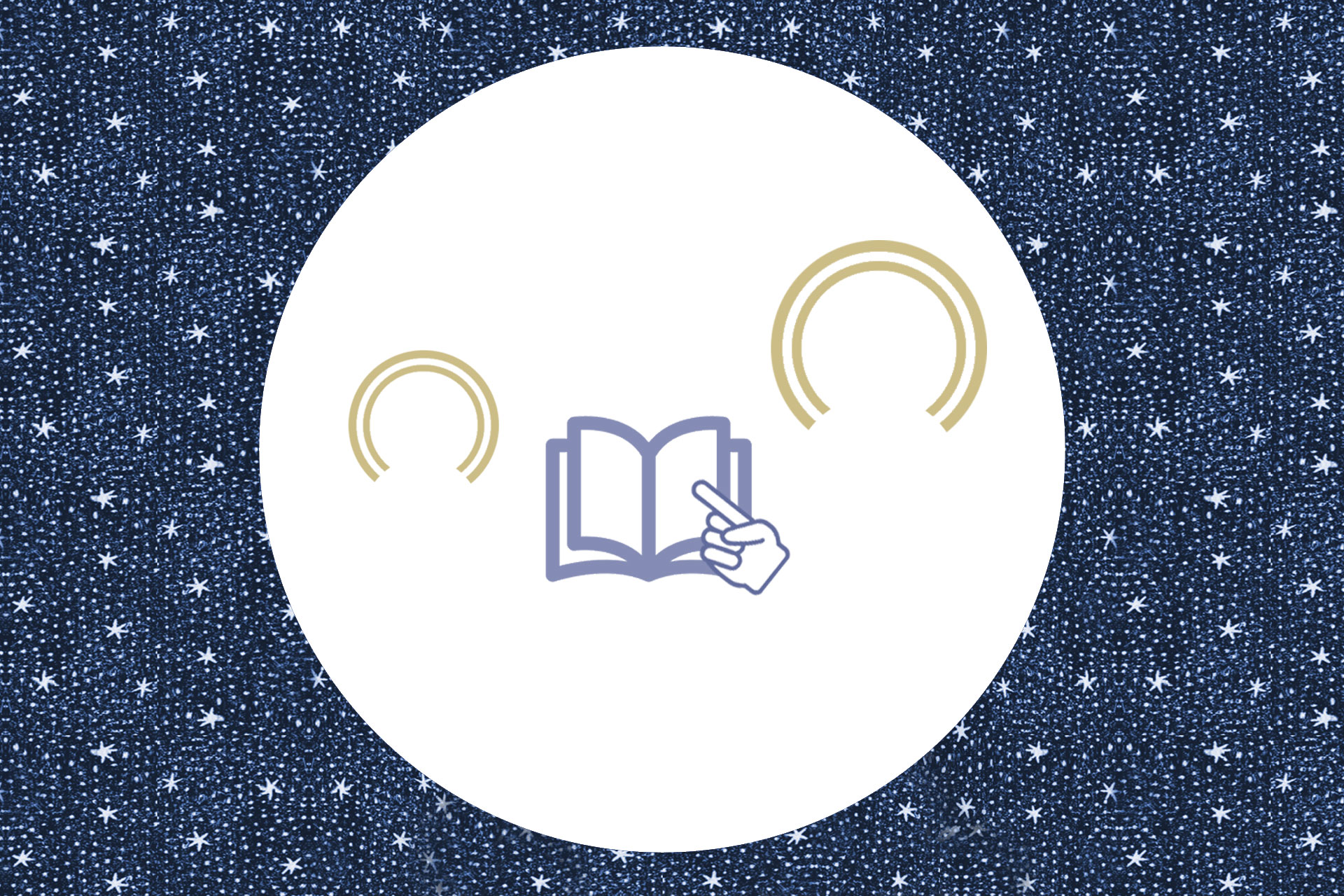
(von Bernd Overwien, Mai 2025)
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein Bildungskonzept, das auch für die Grundschule eine zunehmend wichtige Rolle spielt. In der gegenwärtigen Welt kann zwar schulischer Unterricht keine Lösungen für die gesellschaftlichen Krisen und Gestaltungsaufgaben bieten. Er kann aber Fragen von Kindern aufnehmen und Ängste, die Kinder an vielen Stellen mit den Erwachsenen gemeinsam haben, behutsam thematisieren und Ideen für Handlungsmöglichkeiten entwickeln helfen. Forschung und auch Beispiele aus der Unterrichtspraxis zeigen, dass es möglich ist, belastende Themen wie Kriege in der Grundschule zu bearbeiten. Bei aller Vorsicht kann es gelingen, zu einer Stärkung der Resilienz beizutragen (vgl. Kaldeweit 2019; Peuke/Overwien 2024).
Bearbeitung komplexer Problemlagen in der Grundschule
Auch die Umwelt- und Klimakrise ist allgegenwärtig, in Medien und Alltagsgesprächen. Die mit solchen Krisen verbundene Flut von negativen Emotionen kann sowohl auf Kinder, aber auch auf Erwachsene überwältigend wirken und Ohnmachtsgefühle auslösen (vgl. Asbrand u.a. 2024; Petri 2022). Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte Räume aufmachen, um mit derartigen Gefühlen der Kinder umzugehen, es sollten aber vor allem auch positive Emotionen, wie Hoffnung, Zuversicht und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gestärkt werden. Immerhin gilt: „Sobald wir Krisen benennen, verbinden wir damit zugleich die Hoffnung auf ihre Bewältigung durch menschliches Handeln.“ (Patzel-Mattern 2021, S. 16).
Natur und Umwelt bieten jenseits von Katastrophenszenarien und auch abseits von naiven märchenhaften Zuschreibungen, spannende und befriedigende Erfahrungswelten, die in schulische Lernprozesse eingebunden sein können.
Nicht selten stößt die Bearbeitung komplexer Problemlagen in der Grundschule auf Bedenken hinsichtlich einer Überforderung der Kinder. Grundsätzlich sind Überlegungen zur jeweiligen Lerngruppe und ihren Ausgangsbedingungen bei der Gestaltung des Unterrichts einzubeziehen. Hier gilt, dass es um reflektorische Vorbereitungsprozesse geht, in denen „… die Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen in entwicklungsangemessenen Hinsichten…“ (Prengel 2022, S. 38) berücksichtigt wird. Überdies gilt es als empirisch belegt, dass Grundschulkinder im Rahmen schulischen Lernens kognitiv wie moralisch in der Lage sind, eigene Urteile zu fällen. Ebenfalls belegbar ist das Interesse und die Motivation von Grundschulkindern, sich mit entsprechenden Fragen auseinanderzusetzen (vgl. Röhner u.a. 2023, S. 74). Eine Studie von Gaubitz (2018) zeigt zudem, dass Schüler*innen zwischen acht und elf Jahren im Umgang mit Ressourcendilemmata, in deren Rahmen sich die mit den Dimensionen nachhaltiger Entwicklung verbundenen Werte gegenüberstehen, sehr wohl in der Lage sind, Wertediskussionen nachhaltiger Entwicklung und wesentliche Probleme des globalen Wandels zu erfassen und Probleme und Spannungen zu benennen. Vorliegende Forschungsergebnisse können also Anlass sein, Lernenden etwas zuzutrauen, sie „…als politische Subjekte im BNE-Kontext ernst zu nehmen…“ und ihre Urteilsfähigkeit zu fördern (vgl. Röhner u.a. 2023, S. 74).
Sachunterricht und Allgemeinbildung
Der Sachunterricht der Grundschule hat sich grundlegend immer wieder an Überlegungen Wolfgang Klafkis zur Allgemeinbildung orientiert. Die von ihm benannten „epochaltypischen Schlüsselprobleme“ thematisierten schon Umweltfragen oder Herausforderungen der Digitalisierung, als diese in der breiten Öffentlichkeit noch wenig diskutiert wurden. Bei Klafki werden ökologische Problemstellungen nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen und Einbindungen (Klafki 1992; vgl. Böse 2023, S. 38) und das Erkennen dieser Zusammenhänge als Bildungsziel benannt. Die daraus folgende Vielperspektivität, die wesentlich für den Sachunterricht ist, fordert einen Unterricht, der sich auf gesellschaftliche Fragen bezieht und diese zum Gegenstand macht. Neuere Überlegungen zu einer transformatorischen Bildung bieten hier Anschluss. Bildung wird dabei verstanden als Chance die Selbst- und Weltverhältnisse grundlegend zu reflektieren, zu hinterfragen und neu zu denken. Bildungsprozesse sind verbunden mit einem „Krisengeschehen, das auf Herausforderungen und neue Problemlagen reagiert, die mit bisherigen Mitteln nicht mehr bearbeitet werden können.“ (Koller 2015, S. 30). Bildung kann in diesem Verständnis dazu beitragen bestehende Ordnungen der Wahrnehmung, des Denkens und des Handelns neu zu strukturieren (vgl. Peuke/Overwien 2024). Bezogen auf BNE bedeutet dies, dass sowohl die Wahrnehmung der Komplexität von Nachhaltigkeitsthemen als auch dem lernendem Subjekt als Ganzem mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen Rechnung getragen wird.
Individuelles Handeln und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse
Viel zu oft wird in der Bildungspraxis, aber auch in Bildungskonzepten nationaler und internationaler Organisationen, das individuelle Verhalten der Lernenden adressiert, anstatt konflikthafte gesellschaftliche Aushandlungsprozesse zugänglich zu machen. Zwar ist eine Thematisierung des eigenen nachhaltigkeitsgerechten Verhaltens sicher relevant; dies ist aber kaum widerspruchsfrei zu realisieren. Es muss also um ein angemessenes Verhältnis zwischen eigenen Möglichkeiten und gesellschaftspolitischen Zielen und Forderungen gehen. Dies deutet auf die Relevanz politischer Bildung und Demokratiebildung hin. Jenseits eines solchen Verständnisses besteht ansonsten die Gefahr, dass BNE eine Art Ersatz für politisches Handeln wird. Auch Bade (2024) sieht in Theorie und Praxis der BNE eine zu ausgeprägte Konzentration auf das individuelle Handeln der einzelnen Personen. Konsum- und Mobilitätsentscheidungen, Einsparungen bei Wasser und Energie stehen im Vordergrund, während klimarelevante Wirkungen von Landwirtschaft und Industrieproduktion zu wenig in den Blick genommen werden. Gerade auch in der Grundschule, wo Kinder zu „Klimahelden“ und „Weltenrettern“ werden und eine „Verantwortungsüberfrachtung“ stattfinde, könnten Prinzipien und Methoden der politischen Bildung hilfreich sein und auch den Blick weiten auf politisch-gesellschaftliche Fragen und Möglichkeiten der politischen Partizipation (Bade 2024, S. 209).
Kontroversen und pädagogische Beziehungen
BNE wird vielfach mit einem komplexen und vieldimensionalen Anspruch verbunden, der sich letztlich aber auch aus einer Lebenswelt- und Kindorientierung und auch dem Anspruch inklusiven Unterrichtens ergeben muss. Die damit verbundenen Anforderungen und Möglichkeiten sind vielfach diskutiert, was aber noch fehlt, ist eine Verbindung zwischen einer „Pädagogik der Vielfalt“ mit anerkennenden pädagogischen Beziehungen (Prengel 2019) und den Ansätzen der BNE. Erste Überlegungen dazu liegen vor (Vierbuchen/Rieckmann 2020, O’Donoghue/Roncevic 2020). Es versteht sich dabei von selbst, dass Kinder in wertschätzenden pädagogischen Beziehungen nicht überwältigt werden. Sie sollen sich, wo immer möglich, in kontroverser Diskussion eine eigene Positionierung erarbeiten. Nicht nur der Beutelsbacher Konsens mit seinem Überwältigungsverbot, dem Kontroversitätsgebot und dem Gebot der Orientierung an den potentiellen Einflussmöglichkeiten der Lernenden ist hier wichtig (Overwien 2019). Der Blick auf Kinder sollte von einer „egalitären Differenz“ (Prengel 2019) geprägt sein, sie sind nicht Objekte, sondern Subjekte ihres Lernprozesses. Dieses Subjekt-sein ist als „entwicklungsangemsessene Autonomie“ (Prengel 2022, S. 38). Es bedarf in diesem Sinne pädagogischer Überlegungen für die Rahmung von Lernprozessen, innerhalb derer Partizipation möglich ist. Gebraucht werden also vielfältige und sinnstiftende Antworten auf Fragen nach der Gestaltung entsprechender Lernumgebungen. Zunächst Lehrende und dann im Erfolgsfall auch Lernende entwickeln ein Bewusstsein für den Umgang mit Komplexität und Unsicherheit.
Literatur
Asbrand, Julia, Felix Peter, Claudia Calvano und Lea Dohm. 2024. Umgang mit gesellschaftlichen Krisen im Schulalltag. Göttingen.
Bade, Gesine (2024): BNE politischer denken! Politische Bildung als Grundpfeiler von BNE-Lernsettings im Sachunterricht. In: Becher, Andrea; Gläser, Eva; Kallweit, Nina (Hrsg.): Politische Bildung im Sachunterricht. Potenziale – Positionen – Perspektiven, S. 207-215
Böse, Sarah (2023): Die Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sachunterricht. Eine rekonstruktive Fallstudie zu Motiven von Lehrkräften in der Grundschule. Bad Heilbrunn
Gaubitz, Sarah (2018): Wertorientierungen von Grundschulkindern im Kontext nachhaltiger Entwicklung. Eine empirische Untersuchung zum moralischen Urteilen über Ressourcendilemmata. Wiesbaden.
Kallweit, Nina (2019): Kindliches Erleben von Krieg und Frieden. Eine phänomenografische Untersuchung im politischen Lernen des Sachunterrichts. Wiesbaden.
Klafki, Wolfgang (1992): Allgemeinbildung in der Grundschule und der Bildungsauftrag des Sachunterrichts. In Brennpunkte des Sachunterrichts. Vorträge zur Gründungstagung der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts e.V. vom 19. bis 21. März 1992 in Berlin, Hrsg. Roland Lauterbach, Walter Köhnlein, Kay Spreckelsen und Elard Klewitz, 11-31. Kiel: IPN.
Koller, Hans-Christoph (2015): Probleme und Perspektiven einer Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. In Bildung im und durch Sachunterricht (= Probleme und Perspektiven des Sachunterrichts: Bd. 25) Hrsg. Hans-Joachim Fischer, Hartmut Giest und Kerstin Michalik, 25-37, Bad Heilbrunn.
O’Donoghue, Rob; Roncevic, Katarina: The development of education for sustainable development – materials for inclusive education in South African curriculum settings – In: ZEP : Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 43 (2020) 1, S. 20-26
Overwien, Bernd (2019): Politische Bildung ist nicht neutral. Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit 1:26–38.
Patzel-Mattern, Katja (2021): Krisenbegriff und Krisenphänomene. Journal für politische Bildung Heft 4:12-16.
Petri, Annette (2022): Emotionen und politisches Lernen. In: Handbuch Politische Bildung, Hrsg. Wolfgang Sander und Kerstin Pohl, 338-345. Frankfurt/Main.
Peuke, Julia; Overwien, Bernd (2024): Der Blick auf Kinder – Krisen und Konflikte im Elementar- und Primarbereich thematisieren. In Zeitschrift für Grundschulforschung
Prengel, Annedore (2019): Pädagogik der Vielfalt : Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden (4.Auflg.)
Prengel, Annedore (2022): Kann es in unserer pluralen Welt ein verbindliches pädagogisches Ethos geben? – In: Berndt, Constanze [Hrsg.]; Häcker, Thomas [Hrsg.]; Walm, Maik [Hrsg.]: Ethik in pädagogischen Beziehungen. Bad Heilbrunn, S. 31-42.
Röhner, Charlotte, Bade, Gesine; Butterer, Hanna; Gaubitz, Sarah (2023): Politische Urteilsfähigkeit und Agency von Kindern im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Haider, Michael u.a.[Hrsg.]: Nachhaltige Bildung in der Grundschule. Bad Heilbrunn , S. 69-77.
Vierbuchen, Marie-Christine; Rieckmann, Marco: Bildung für nachhaltige Entwicklung und inklusive Bildung. Grundlagen, Konzepte und Potenziale – In: ZEP : Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 43 (2020) 1, S. 4-10
Autor und Bezug zu Annedore Prengel
Annedore Prengel habe ich im Rahmen eines Buchprojektes erstmals erlebt. 2007 kam mit Venor Muñoz Villalobos ein Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen nach Deutschland. Er sollte einen kritischen kinder- und menschenrechtlichen Blick auf unser Schulsystem richten und kam zu einer sehr kritischen Einschätzung über die Möglichkeiten das Recht auf Bildung wirklich wahrnehmen zu können. Wir versammelten eine Reihe von Autor*innen in einem Band, die die damit verbunden Problematiken aus viellerlei Perspektiven untersuchten bzw. auch konkretisierten.
In der Folge begegnete ich Annedore Prengel in Reckahn, Kassel oder Frankfurt und es gab immer lebhafte und spannende Gespräche.