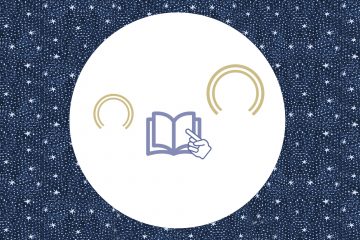Sich begegnen – Kinder befragen ältere Menschen
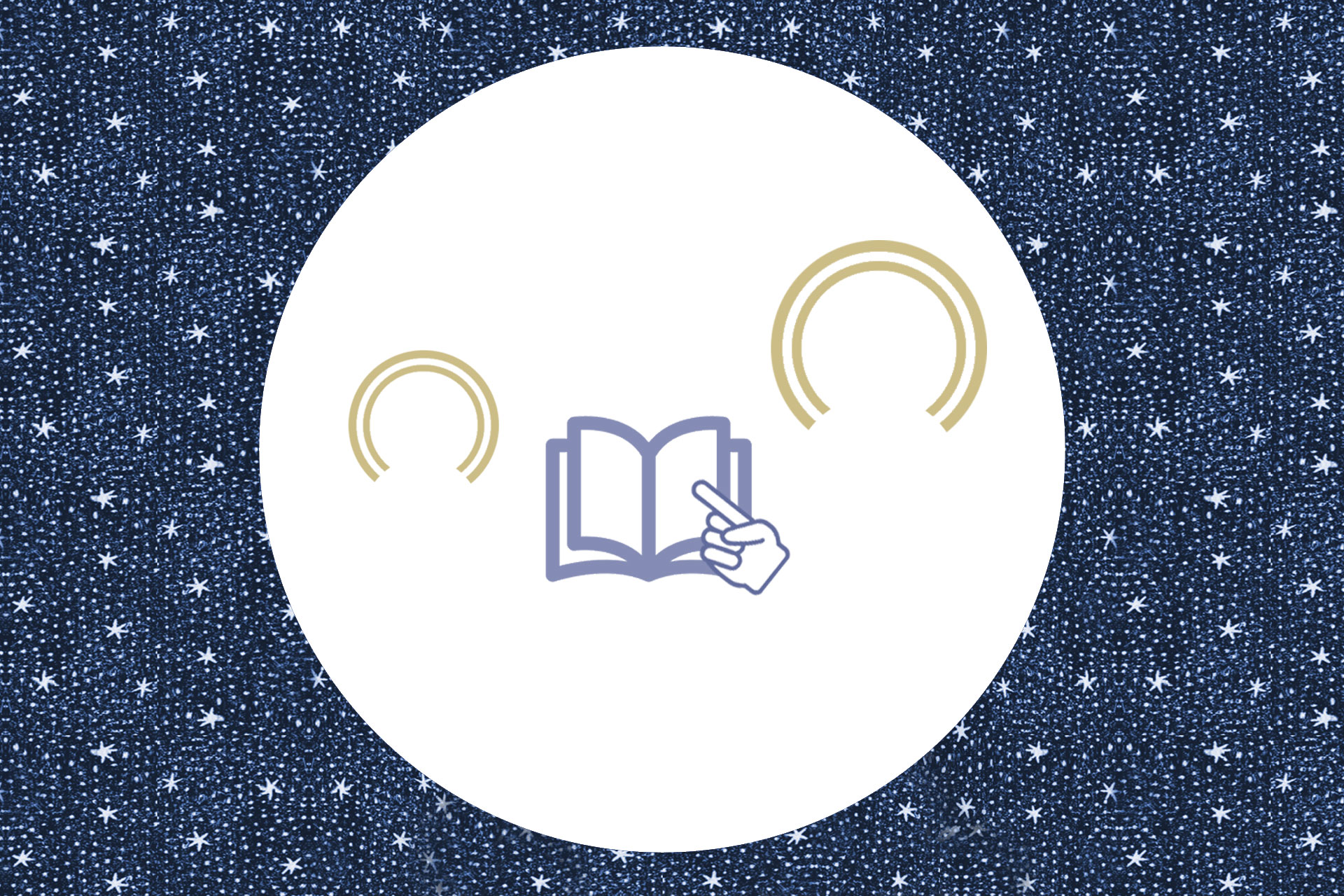
Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel
(von Detlef Pech, Juli 2025)
Ausgangspunkt
In den vergangenen gut 10 Jahren beschäftigte sich die Sachunterrichtsdidaktik an der Humboldt-Universität zu Berlin aus verschiedenen Perspektiven mit Gesprächen von Kindern mit älteren Menschen.
Didaktisch gesehen ist diese Beschäftigung naheliegend. Werden doch mittlerweile in fast allen Grundschulcurricula und in diversen Fachartikeln Zeitzeug*innengespräche als besondere Möglichkeit des frühen historischen Lernens angesehen. Um die Positionierung schon vorab festzuhalten: Wir sind hier deutlich skeptischer als der Großteil der Publikationen und zugleich sehen wir in diesen Gesprächen deutlich mehr Potenzial als die meisten vorliegenden Publikationen. Was zunächst widersprüchlich klingt, soll im Folgenden aufgeschlüsselt werden.
Kinder begegnen älteren Menschen
Die Gespräche von Kindern mit älteren Menschen, auf die sich hier bezogen wird, sind in verschiedenen Vorhaben entstanden. Ausgangspunkt war das Projekt „jung fragt alt“ des Kinderrings e.V. Berlin. Dabei handelte es sich um ein freiwilliges Angebot für Kinder von Grundschulen am Nachmittag, indem diese Kinder Senior*innen in Heimen besuchten und diese mithilfe selbst überlegter Fragen interviewten (vgl. Blankenhorn, Karnetzki & Pech 2014). Dieses Projekt wurde mehrmals durchgeführt. Durch die Begleitung des Vorhabens von einer Filmemacherin ist auch ein öffentlicher Einblick möglich, da die Filme auch in der Online-Plattform youtube dokumentiert sind. Weitere Gespräche wurden auf Grundlage der Erfahrungen gezielt im Rahmen eines vom BMBF geförderten Forschungsvorhabens ( „Kindheitserinnerungen – Narrative im Erinnerungsdialog von Grundschüler*innen mit alten Menschen aus der DDR“ FZ 01UJ1912AY) erhoben, wo indes ein spezifischer Schwerpunkt im Vordergrund stand, nämlich dass die älteren Menschen den Großteil ihres Lebens in der DDR verbracht haben (vgl. Pech, Peuke & Urban 2021; Peuke, Pech & Urban 2021; Peuke, Pech & Urban 2022). In der Weiterführung dieses Vorhabens werden diese Begegnungen aktuell ergänzt durch Gespräche zwischen Kindern und älteren Menschen, die im Westen gelebt haben.
Verbindendes Element all dieser Gespräche ist, dass es Begegnungen von Kindern mit älteren Menschen sind, die nicht zur jeweiligen Familie gehören. In der Regel sind es tatsächlich fremde ältere Menschen mit denen die Kinder in 1:1 oder 2:1 Situationen sprechen. Eben dieses Element ist auch aus kindheitswissenschaftlicher Perspektive besonders interessant, da es zwar an vielen Kitas und Schulen mittlerweile Kooperationen mit Senior*inneneinrichtungen gibt, auf der Forschungsseite über die Kommunikationsstrukturen und -intentionen zwischen Kindern und älteren Menschen indes kaum etwas bekannt ist – erst recht mit Blick auf didaktische Potenziale oder einer kindheitswissenschaftlichen Sicht auf die Wahrnehmung dieser Gespräche von Kindern. Die wenigen vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten bspw. im Kontext des Sprechens über die DDR richten ihr Augenmerk in der Regel auf intergenerationale Aspekte in den Familien (z.B. Haag 2018). Auch im öffentlichen oder populärwissenschaftlichen Diskurs wird, wenn es um die Kommunikation älterer Menschen mit Kindern geht, zumeist auf innerfamiliären Austausch verwiesen (z.B. Michel & Grimm 2024).
Kurz gefasst hat uns zunächst interessiert: Was wollen Kinder von älteren Menschen wissen? Diese Frage wurde im weiteren Verlauf ergänzt durch die Frage: Was erzählen ältere Menschen (ihnen unbekannten) jüngeren Kindern?
Kinder fragen zu (Zeit-)Geschichte
Beide Fragen werden in der didaktischen Diskussion kaum aufgegriffen. Dort steht mit Blick auf Zeitzeug*innen, die in den Unterricht eingeladen werden können, der Aspekt einer ‚lebendigen Geschichte‘ zumeist im Vordergrund. In der unterrichtsbezogenen Literatur wird zudem betont, dass entsprechende Gespräche sehr gut vorbereitet sein müssen (z.B. Michalik 2020. S. 45), um ertragreich zu sein. Hier dominiert eine Perspektive, die das unterrichtlich gewollte Ergebnis und nicht das Interesse von Kindern in den Vordergrund der Fragen rückt. Interessant wird es aber, wenn man die Kinder ‚einfach machen lässt‘. Welche Fragen wählen sie dann, wie verlaufen solche pädagogisch nicht vorbereiteten Interviews? Es dominieren Sachfragen. Vielleicht beeinflusst durch Kenntnisse zu Interviews, die bereits vorhanden sind, oder durch den (schulischen) Umgang mit Sachtexten. Zugleich finden sich aber bei einigen Grundschulkindern auch ohne gezielte Vorbereitung bereits systematische und interessengeleitete Fragetechniken. Es gibt durchaus Kinder, die ihren individuell vorbereiteten Fragen, Nachfragen folgen lassen, die sich auf die gerade erhaltenen Informationen aus dem Interview beziehen (vgl. Hempel & Pech 2016), die das Interview also gezielt nutzen, um Informationen zu generieren. Oft wird dabei zunächst einfach in der Reihenfolge gefragt, wie die Fragen den Kindern eingefallen sind und wie sie notiert wurden – was nicht selten bei den älteren Menschen zu Irritationen führt. So kann es durchaus sein, dass auf die Frage „Hattest Du ein Haustier?“ die Frage „Hast Du auch Hitler getroffen?“ folgt. Es war ein Lernprozess, dass nicht selten die Zeitzeug*innen intensiver auf die Gespräche vorbereitet werden mussten als die Kinder – die gerade angeführten Beispielfragen entstammen einem der allerersten dokumentierten Gespräche in dem eine Gruppe von Grundschulkindern eine Frau interviewte, die als Kind den Holocaust überlebte und für die es sichtbar schwierig war, diese Fragestruktur nicht als Relativierung und Verharmlosung dessen zu verstehen, was sie erleben musste. Das ‚Reihenfolgemerkmal‘ gab es sogar bei den Kindern, die in der Lage waren, aktiv noch im Gespräch Nachfragen zu den gehörten Erzählungen zu stellen – die Nachfragen folgten hier erst, nachdem der eigene Fragenkatalog abgearbeitet war.
Ältere Menschen aus der DDR erzählen
Mit Blick auf die Erzählungen älterer Menschen „aus der DDR“ wurde in den ersten Schritten das Datenmaterial aus dem Projekt „jung fragt alt“ ausgewertet. Deutlich wurde bereits hierbei, dass die Erzählungen der älteren Menschen sich an dem Alter der Kinder orientierte, die die Interviews führten. D.h. der Schwerpunkt ihrer Erzählungen lag auf der eigenen Kindheit und da es sehr alte Menschen waren, bedeutete es, dass es Erzählungen über Kriegserfahrungen waren. Alternativ zur Deutung, dass die Erzählungen sich am Alter der Interviewenden orientieren, wäre die Vermutung, dass Kriegserfahrungen als Kind besonders stark verankert sind, was durchaus mit den Intentionen der alten Menschen korrespondiert, die immer wieder mahnende Worte fanden und die Furchtbarkeit des Krieges betonten. Obwohl diese älteren Menschen den Großteil ihres Lebens in der DDR verbracht haben, spielt dies in ihren Erzählungen nahezu keine Rolle. Um im BMBF-Forschungsvorhaben entsprechende Erzählungen zu generieren, wurden gezielt etwas jüngere Menschen gesucht, die auch bereits ihre Kindheit in der DDR verbracht haben. 10 der geführten Interviews wurden im Detail mit der Dokumentarischen Methode (vgl. Nohl 2012, Bohnsack 2013) ausgewertet. Auch hier zeigt sich, dass der Schwerpunkt der Erzählungen sich ausrichtet am Alter der Kinder und die eigene Kindheit in den Mittelpunkt gerückt wird. Dabei lassen sich Räume unterscheiden, in denen sich die Erzählungen bewegen, die dann korrespondieren mit Intentionen der Erzählungen. Hervorzuheben ist dabei zunächst, dass sich in allen Erzählungen Intentionen entziffern lassen. Die interviewten Personen wollen den Kindern, die sie interviewen, etwas mitgeben. Unterschieden werden konnte eine Variante, deren Intention darin bestand, Kindern etwas über Kindheit früher mitzugeben und dabei betonte, dass sie eine „andere Kindheit“ als heute und ein einfacheres Leben geführt hätten. In zweiter Variante wurde darauf abgezielt, Kindern etwas über das Leben in der DDR „mitzugeben“. Dabei stand eine DDR-geprägte Kindheit im Mittelpunkt der Erzählung, die verknüpft wurde mit dem organisierten Charakter von Kindheit („Pioniere“) oder auch einem Fürsorgenarrativ mit Blick auf staatliche Institutionen. Die dritte entzifferte Intention lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass etwas über die DDR mitgegeben werden soll. Hierbei steht – in im Vergleich eher unpersönlichen Erzählungen – die Kritik an der DDR im Vordergrund und Ansprüche an demokratische Staaten werden als Vergleichshorizont genutzt.
Perspektivität und Intentionalität berücksichtigen

Fachdidaktische Publikationen thematisierten im Zusammenhang mit einer sich etablierenden Diskussion um Zeitzeug*innen im Unterricht, letztlich von Beginn an die Notwendigkeit der Berücksichtigung und Reflexionsnotwendigkeit der Perspektivität der Erzählungen als auch der Bedingtheit von Erinnerungen und dem Überwältigungscharakter authentischer Erzählungen (z.B. Schreiber 2009, S. 21). Und auch wenn es zumindest die grundschulbezogenen Lehrpläne (z.B. im Kerncurriculum Sachunterricht Niedersachsen, Niedersächsisches Kultusministerium 2017) und auch die Aufgabenstellungen in den Schulbüchern (z.B. „Umweltfreunde“, Koch u.a. 2016) dann nur mehr kaum aufgreifen, sieht die fachdidaktische Literatur einen großen Gewinn für das historische Lernen im Umgang mit Quellen eben auch darin, die Unterschiedlichkeit der Erzählungen zu entziffern. Für den Sekundarstufenbereich liegen in diesem Feld auch empirische Befunde vor (z.B. Bertram 2017), für den Grundschulbereich eher allererste empirische Hinweise (Diederich 2019). Dass die Zeitzeug*innen aber auch ein Interesse haben, bestimmte Erzählungen zu generieren, bestimmte Narrative aufzugreifen, weil ihre Erzählungen intentional sind, wird zumindest bezogen auf den Grundschulbereich dabei nicht diskutiert.
Etwas mitteilen, etwas mitgeben als Grenze und als Chance
Die in den verschiedenen Projekten an der Humboldt-Universität geführten Gespräche von älteren Menschen mit Kindern erfolgen grundsätzlich auf Augenhöhe. Mehr noch, auf den ersten Blick sind es die Kinder, die die Struktur vorgeben, denn sie sind diejenigen die die Fragen stellen. In der genaueren Betrachtung zeigt sich indes die Wirkungsmacht der generationalen Ordnung (vgl. Alexi 2014), denn es sind die älteren Menschen, die die Chance ergreifen, ihre Weltsicht, ihre Botschaften, ihre Positionierungen in den Erzählungen zu kommunizieren – in einer Intentionalität, die darauf zielt, dass Kinder ihre Deutungen übernehmen sollten.
Eben dies lässt sich kritisch betrachten und als Problem auch schulischer Zeitzeug*inneninterviews beschreiben. Denn nicht nur die Perspektivität, sondern auch die Intentionalität von Erzählungen zu dekonstruieren, kann für Schüler*innen als herausfordernde Aufgabe beschrieben werden. Auf der anderen Seite ist es eben gerade dieses Moment, dass ältere Menschen etwas mitzuteilen haben, dass sie nicht nur Quelle sind, sondern das Bedürfnis haben, Erfahrungen weiterzugeben und Konsequenzen daraus Kindern mit auf den Weg gegeben zu wollen, bislang weder diskutiert noch systematisch aufgegriffen worden. Die Chance, die darin liegt, durch die Erzählungen nicht nur etwas zu verstehen, sondern für das eigene Leben möglicherweise auch Orientierung zu finden, wäre zumindest wert, beachtet zu werden – auch mit dem Blick auf einen gelingenden und wertschätzenden Austausch zwischen Generationen.
Literatur
- Alexi, Sarah (2014): Kindheitsvorstellungen und generationale Ordnung. Opladen: Budrich
- Bertram, Christiane (2017): Zeitzeugen im Geschichtsunterricht. Chance oder Risiko für historisches Lernen? Eine randomisierte Interventionsstudie. Schwalbach: Wochenschau
- Blankenhorn, Renate; Karnetzki, Mirjam & Pech, Detlef (2014): Jung fragt Alt im Kiez: Geschichte wird lebendig. Ein Projektbericht. In: Grundschulunterricht Sachunterricht (2), S. 16–19.
- Bohnsack, Ralf (2013): Gruppendiskussionsverfahren und dokumentarische Methode. In: Friebertshäuser, Antje et al. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 4., durchgesehene Aufl. Weinheim: Beltz, S. 205-218.
- Diederich, Julia (2019): Vorstellungen von Grundschulkindern zur Zeitzeugenbefragung – eine empirische Untersuchung zu Kompetenzen historischen Denkens. In: Andrea Holzinger u.a. (Hrsg.): Fokus Grundschule Band 1. Forschungsperspektiven und Entwicklungslinien. Münster: Waxmann, S. 189-198
- Haag, Hanna (2018): Im Dialog über die Vergangenheit. Tradierung DDR-spezifischer Orientierungen in ostdeutschen Familien. Wiesbaden: Springer
- Hempel, Alexa & Pech, Detlef (2016): Kinder erforschen Geschichte – Zeitzeug/-inneninterviews zur deutschen Teilung. In: ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung 5, S. 148–161
- Koch, Inge u.a. (2016): Umweltfreunde 4. Ausgabe Brandenburg. Berlin: Cornelsen
- Michalik, Kerstin (2020): Befragung und Zeitzeug/innenbefragung. In: Dietmar von Reeken (Hrsg.): Handbuch Methoden im Sachunterricht. 5. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider
- Michel, Sabine & Grimm, Dörte (2024): Es ist einmal – Ostdeutsche Großeltern und ihre Enkel im Gespräch. Berlin: BeBra
- Niedersächsisches Kultusministerium (2017): Kerncurriculum für die Grundschule Jahrgänge 1-4: Sachunterricht. Hannover
- Nohl, Arnd-Michael (2012): Interview und dokumentarische Methode. Anleitungen für die Forschungspraxis. 4., überarb. Aufl. Wiesbaden: Springer.
- Pech, Detlef; Peuke. Julia & Urban. Jara (2021): Zeitgeschichte erzählen: Das Projekt „Kindheitserinnerungen – Narrative im Erinnerungsdialog von Grundschüler*innen mit alten Menschen aus der DDR“. In: GDSU-Journal, H. 12, Juli 2021, S. 74-86
- Peuke, Julia (2024): Was bleibt – die DDR aus der Perspektive von Kindern. Eine qualitative Studie zum historisch-politischen Lernen im Sachunterricht. Wiesbaden: Springer VS
- Peuke, Julia; Pech, Detlef & Urban, Jara (2021): Etwas mitgeben – Gespräche zwischen Grundschulkindern und älteren Menschen aus der DDR. In: Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften, H.2 2021, S. 141-159
- Peuke, Julia; Pech, Detlef & Urban, Jara (2022): Wie war das damals? Gespräche mit Zeitzeug*innen im Kontext des frühen historischen Lernens. In: ZISU, 11/2022, S. 172-186
- Schreiber, Waltraud (2009): Zeitzeugengespräche führen und auswerten. In: Waltraud Schreiber & Katalin Arkossy (Hrsg.): Zeitzeugengespräche führen und auswerten. Historische Kompetenzen schulen (= Themenhefte Geschichte, 4). Neuried: Ars Una, S. 21-28
Autor
Detlef Pech ist Professor für Grundschulpädagogik mit dem Schwerpunkt Sachunterricht und seine Didaktik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkt liegen in den Bereichen (zeit-)geschichtlicher und politischer Bildung von/mit Kindern als auch dem Verhältnis von Fachdidaktik und Inklusion. Kontakt: detlef.pech@hu-berlin.de
Bezug zu Annedore Prengel
Annedore Prengel begegnete mir deutlich früher als ich ihr. Das Wagnis eines Lektürekurses in der Sachunterrichtsdidaktik mit ihrer „Pädagogik der Vielfalt“ gehört zu den guten Erinnerungen an die Lehre als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Kurz nach Antritt meiner Professur an der HU war Annedore Prengel die erste mit der ich eine Dissertation betreute – auch wenn die Fertigstellung noch dauerte. In und um Berlin begegneten wir uns dann häufig – denn alles rund um Kinder- und Menschenrechte trieb uns beide um. So hatte ich die Freude mich zumindest immer wieder einmal an den jährlichen Tagungen im Rochow-Museum und der Entstehung der Reckahner Reflexionen zu beteiligen.