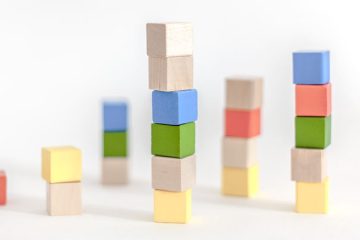Scham als Hindernis für kollegiale Reflexionsprozesse von Lehrkräften?
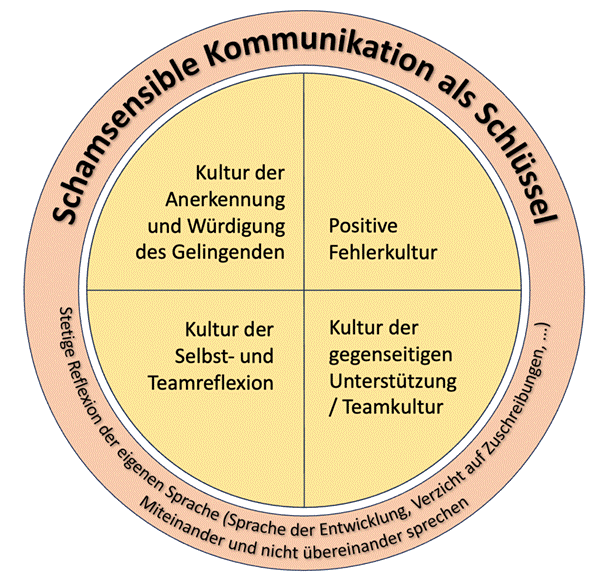
(von Simone Götzinger, Mathias Hinderer, Diana Franke-Meyer, Juli 2025)
Im Kontext Schule ist die gemeinsame Reflexion pädagogischer Situationen von großer Bedeutung, wenn ethische Pädagogik etabliert werden soll und Schulen sich als „fürsorgliche Gemeinschaft“ (vgl. Prengel 2019a) begreifen wollen. Dies steht auch im Einklang mit Ergebnissen der Bildungsforschung (vgl. Gräsel, Fußangel und Pröbstel 2006, S.205), die aber zugleich herausarbeiten, dass in Bezug auf die Zusammenarbeit in Deutschland noch Ausbaupotenzial besteht (ebd., S. 205) Im Rahmen des Beitrags wollen wir den Aspekt gemeinsamer Reflexion pädagogischer Situationen in den Blick nehmen. Was sind die guten Gründe, die gemeinsames Reflektieren unter Lehrkräften so erschweren? Dieser Fragestellung gingen die Autor:innen dieses Beitrags im Rahmen einer 2-tägigen Konferenz in Reckahn im Oktober 2024 nach.
Eine kollegiale Reflexion pädagogischer Situationen kann als Teil einer „kokonstruktiven Kooperation“ von Lehrkräften betrachtet werden (vgl. Gräsel, Fußangel und Pröbstel 2006). Diese Form der Zusammenarbeit ist mehr als „Austausch“ und reine „Arbeitsteilung“ (vgl. ebd.). Sie bezieht reflexive Prozesse explizit mit ein. Als Gründe für die geringe Ausprägung dieser Kooperationsform in deutschen Lehrerkollegien nennen Grosche, Fussangel und Gräsel u.a. „ungünstige organisatorische Rahmenbedingungen (z.B. fehlende Zeit)“ (2020, S.462). Auch wird in Rückgriff auf Lortie (1972) beschrieben, dass das tradierte Berufsbild der Lehrkraft „von der Abgeschiedenheit der Lehrenden im Unterricht geprägt“ (ebd.) sei. Womöglich hat sich dies in den letzten Jahrzehnten durch die Weiterentwicklung inklusiven Unterrichts etwas verändert, dennoch scheinen Lehrkräfte nach wie vor häufig mit Sorge erfüllt zu sein, wenn eigene Arbeitsweisen geteilt oder offengelegt werden sollen. Grosche, Fussangel und Gräsel konstatieren entsprechend, dass eine zentrale Vorbedingung für kokonstruktive Kooperation „die Bereitschaft zur Deprivatisierung des eigenen Lehrerhandelns“ (S.470; Hervorhebung im Original) sei.
Als mögliches Hindernis hierfür möchten wir an dieser Stelle Schamprozesse, wie sie z.B. durch Stephan Marks in die Diskussion eingebracht wurden (vgl. Marks 2024), ins Bewusstsein rücken. Denn als Gefühl, das sich eher verborgen manifestiert, kommt Scham ja gerade dann zum Tragen, wenn etwas Persönliches oder Privates ins Licht der Öffentlichkeit gerät. Die Aufforderung zur „Deprivatisierung des Lehrerhandelns“ als Voraussetzung für kollegiale Reflexion legt diesen Fokus also nahe.
Mit Marks (2024) möchten wir dafür werben, dass wir uns als Lehrpersonen berufstypische Situationen und Strukturen bewusst machen, die bei uns ein Gefühl von Scham auslösen können. Denn von Kindesbeinen an haben wir gelernt, „Emotionen wie Scham nicht zu fühlen, sondern durch andere, weniger unerträgliche Verhaltensweisen – Abwehrmechanismen – zu ersetzen. (…) Scham zu merken kann dann beginnen, wenn wir diese Emotion enttabuisieren, anerkennen und verstehen“ (Marks 2024, S.182).
Aspekte, die im Kontext der Scham bei Lehrkräften nach Marks eine Rolle spielen, sind zunächst die individuellen Erfahrungen der einzelnen Lehrkraft mit Scham-Momenten in der eigenen (Lern-)Biografie, die das spätere Verhalten als Lehrkraft prägen (vgl. Marks 2024, S.174). Zudem sind auch „strukturelle Kränkungen“ im System Schule von Bedeutung, z.B. im Hinblick auf Zeitstrukturen, Architektur von Schulgebäuden, abwertende Rückmelde- und Zeugniskulturen, Output-Orientierung, Selektionsauftrag der Schule, Betrachtung von Schüler:innen als wirtschaftliches „Humankapital“ bis hin zu „strukturellem Zynismus“ (vgl. Marks 2024, S.148ff). Hinzu kommt, dass Scham ebenfalls bei Lehrkräften ausgelöst werden kann, wenn sie Zeugen von Beschämung, z.B. Beschämung von Schüler:innen durch Kolleg:innen werden (vgl. Marks 2024, S.176).
Vier Formen von Scham und ihre möglichen Entsprechungen im Berufsbild einer Lehrkraft
Marks nennt in seinem sehr lesenswerten Buch „Scham – Die tabuisierte Emotion“ vier Formen von Scham, die allesamt auch bei Lehrkräften bedeutsam sein können. Entsprechend soll hier die Hypothese aufgestellt werden, dass gemeinsame Reflexion und kokonstruktive Kooperation massiv erschwert werden, wenn Lehrkräfte zu viel Energie auf die Vermeidung des Erlebens einer dieser Schamformen aufwenden müssen. Und da die Scham als „vielleicht schmerzhafteste aller menschlichen Emotionen“ (Marks 2024) gilt, muss befürchtet werden, dass die Angst vor der Scham dazu in der Lage ist, Unterrichts- und Schulentwicklung zu blockieren oder die Implementierung einer ethischen Pädagogik zu verhindern.
a) Die mögliche Sorge von Lehrkräften vor Missachtung
Die erste Schamform, die Marks beschreibt, bezieht sich auf die Gefühle, die in uns Menschen ausgelöst werden, „wenn wir in unserer Einzigartigkeit nicht gesehen oder missachtet werden“ (Marks 2024, S.20). Wir alle möchten von anderen gesehen und verstanden werden, wichtig sein. Das Bedürfnis nach Anerkennung spielt bei dieser Schamform, der sogenannten „Missachtungs-Scham“, eine entscheidende Rolle (vgl. Marks 2024, S.20f).
Betrachten wir das Lehrerbild in Deutschland, so muss leider festgehalten werden, dass eine öffentliche Missachtung dieser Berufsgruppe sehr häufig anzutreffen ist. Schlecht über Lehrkräfte zu reden, Faulheit oder Inkompetenz nachzusagen, „Lehrkräfte zu beschämen ist üblich und alltäglich“ (Marks 2024, S.145). In Bezugnahme auf die Erfahrungen aus seinen eigenen Fortbildungsveranstaltungen verweist Marks darauf, dass „sehr viele Lehrerinnen und Lehrer … in ihrem Selbstwert verletzt, gekränkt und somit krank gemacht werden“ (ebd.).
Im Hinblick auf das Bedürfnis nach Anerkennung für das berufliche Handeln erkennen wir zudem eine strukturelle Problematik, die spezifisch für die Konstellation von Schule und Unterricht ist: Es sind in der Regel die Schüler:innen, die das Tun und die Leistungen einer Lehrperson erleben und bezeugen. Eine Lehrkraft erfährt also Selbstwirksamkeit und „An-Erkennung“ ihrer Bemühungen zu einem ganz wesentlichen Maße durch ein Gegenüber, das sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihr befindet.
Dies erscheint uns in mehrfacher Hinsicht problematisch – nicht nur in Bezug auf das Erleben eines möglichen Mangels an Anerkennung. So kann die asymmetrische Machtverteilung im Schüler:in-Lehrer:in-Verhältnis bei der Lehrperson einen fortwährenden Zweifel daran nähren, ob es sich bei Rückmeldungen durch Schüler:innen um „intersubjektive Anerkennung zwischen gleichberechtigt Verschiedenen“ (Prengel, 2019b, S.57) handelt, oder eher um den Ausdruck einer strategischen Interpretation dieses Machtverhältnisses, was eine „Verzweckung“ der Beziehung und der Lehrperson in ihrer Bewertungsfunktion bedeutet. Eine ganz wesentliche Quelle von Anerkennung für zentrale Aspekte des beruflichen Handelns steht dann dauerhaft in Frage.
Konstruktiv gedacht, müsste eine erste Schlussfolgerung lauten: Wenn Lehrkräfte zu mehr kollegialer Reflexion ermutigt werden sollen, braucht es eine Stärkung der Kultur der Anerkennung und Würdigung des Gelingenden auf Peer-Ebene. Sicherlich werden Lehrerkollegien nur geringen Einfluss auf gesamtgesellschaftliche Prozesse haben. Dennoch könnte es zumindest im Kollegium selbst zu einem geteilten Anliegen werden, Missachtung und Beschämung zu verringern und für ein Miteinander einzutreten, das die Würde wahrt. In eine solche Kultur der Anerkennung und Würdigung des Gelingenden sollten alle Menschen der Schulgemeinschaft eingeschlossen sein.
b) Die mögliche Sorge von Lehrkräften vor Bloßstellung
Die zweite von Marks beschriebene Schamform, die sogenannte „Intimitäts-Scham“ tritt auf, wenn das Grundbedürfnis nach Schutz verletzt wird. Wir alle möchten, dass mit dem, was wir von uns zeigen, respektvoll umgegangen wird und unsere Grenzen gewahrt werden (vgl. Marks 2024, S.27).
Trotz der weiter oben beschriebenen „Privatheit“ des Klassenzimmers stehen Lehrkräfte gleichzeitig auch unter starker Beobachtung. Entscheidungen, die sie aus bestem Wissen und Gewissen treffen, werden in Eltern-WhatsApp-Gruppen diskutiert, Fehler werden durch Beschwerden an die Schulaufsicht angeprangert. Auch im Kollegium selbst wird das Grundbedürfnis nach Schutz bisweilen verletzt: Marks berichtet von einer Kollegin, die „noch ganz aufgewühlt von einer missglückten Unterrichtsstunde, im Lehrerzimmer davon erzählte und sich daraufhin von einem Kollegen in überheblichem Ton anhören musste: »Das ist mir noch nie passiert. Ich habe die Klasse im Griff«“ (Marks 2024, S.177). Aus eigener Erfahrung heraus wissen wir, dass das Erlebnis dieser Kollegin kein Einzelfall ist.
Lesch und Zierer nehmen in diesem Kontext auch das in der Schule herrschende Fehlerverständnis kritisch in den Blick: „Denn in der Schule dominiert bis heute ein Verständnis von Fehlern als Makel, als etwas, was es zu vermeiden gilt. Dass Fehler aber der Motor des Lernens, der Entfaltung und der Bildung ist, mag zwar schon länger bekannt sein, aber bis heute hat es dieses Verständnis noch nicht geschafft, im pädagogischen Kontext Fuß zu fassen“ (2024, S.48). Eine Enthüllung eigener Schwächen birgt somit stets emotionale Risiken. Es verwundert also nicht, wenn Lehrkräfte Sorge haben, bloßgestellt zu werden, sollten sie einmal so mutig sein, offen und ehrlich im Kollegium über ihre Nöte und Gedanken in Bezug auf eine Klasse oder einzelne Schüler:innen zu sprechen.
Auch im Hinblick auf diese Form der Scham bringt „Schule“ somit ganz spezifische strukturelle Herausforderungen mit sich. Psychodynamische und systemische Perspektiven einbeziehend, beschreibt Oggi Enderlein, wie das deutsche Schulsystem auf jeder Hierarchieebene vom Druck und der Angst, zu versagen geprägt ist – von der Ebene der Politik und Schulverwaltung über Schulleitung zu Lehrkräften, den Schüler:innen und Eltern (vgl. Ebel 2012). Nicht selten ist diese Angst wechselseitig, wenn etwa sowohl Schüler:innen Angst haben vor ihrer Lehrerin als auch diese Angst vor ihren Schüler:innen. Diese Versagensangst ist Lehrkräften selten bewusst, und noch seltener wird sie offen mit Kolleg:innen besprochen. Unsere Vermutung ist, dass hier eine wirkmächtige Ursache für individuelle Gefühle von Scham, von Selbstzweifeln und des Ungenügens verborgen liegt.
Was es hier brauchen würde, wäre eine positive Fehlerkultur, in welcher Vertrauen als Grundbasis vorhanden ist. Lehrkräfte „müssen die Sicherheit haben, dass sie sich selbst ,enthüllen‘ dürfen… Vertrauen schafft die Grundlage dafür, eigene Unsicherheiten und Ängste zu benennen… sowie Fehler konstruktiv anzusprechen“ (Gosche, Fussangel und Gräsel 2020, S.470).
c) Die mögliche Sorge von Lehrkräften vor Ausgrenzung
Die dritte Schamform, die bei Marks zu finden ist, ist die sogenannte „Ausgrenzungs-Scham“. Sie tritt immer dann auf, wenn „man den Normen, Werten oder Erwartungen der jeweiligen Familie, Gruppe, Sippe oder Gesellschaft nicht gerecht geworden ist“ (Marks 2024, S.35). Zentral ist hier das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.
Ausgrenzungs-Scham kann Lehrkräfte treffen, wenn sie sich nicht an die bewussten oder unbewussten Normen z.B. in einem Lehrerkollegium halten. Sind dies Normen, die z.B. sehr stark auf die pädagogische Freiheit der einzelnen Lehrkraft abheben, entsprechen gemeinsame Absprachen, Reflexionen oder gar ethische Vereinbarungen eher nicht der vorherrschenden Norm. Gräsel, Fußangel und Pröbstel weisen auf solche Zusammenhänge hin: „Zu diesen Normen gehört, dass niemand in den Unterricht einer Lehrkraft eingreifen soll, … dass die Kollegiumsmitglieder zuvorkommend miteinander umgehen und sich nicht gegenseitig in ihre Angelegenheiten einmischen“ (Gräsel, Fußangel und Pröbstel 2006, S.208f). Auch hier werden emotionale Hürden genannt, die bei einem Durchbrechen der Norm auftreten können: „Jeder Einzelne muss das Risiko eingehen, Fehler anzusprechen, zu kritisieren und zu hinterfragen bzw. selbst unsicher Vorschläge zu machen, die auf Ablehnung stoßen können“ (Gräsel, Fußangel und Pröbstel 2006, S.211). Es ist also auch diesbezüglich nachvollziehbar, wenn kollegiale Reflexion aufgrund der emotionalen Risiken, die eine Lehrkraft damit eingeht, eher vermieden wird. Nicht zuletzt wird kokonstruktive Zusammenarbeit deshalb auch als „high-cost-Kooperation“ bezeichnet (vgl. ebd.).
Erforderlich wäre also – wenn kooperative Reflexionsprozesse in Lehrerkollegien Einzug halten sollen – eine generelle Teamkultur, die durch eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung unterstrichen wird, so dass sich Lehrkräfte wirklich zugehörig fühlen können. Die Etablierung von unterstützender Zusammenarbeit als Regelfall trägt dazu bei, dass das Prinzip einer „fürsorglichen Gemeinschaft“ (Prengel 2019a) auch von Lehrkräften untereinander wahrgenommen werden kann.
d) Die mögliche Sorge von Lehrkräften, den eigenen Werten und Idealen nicht zu genügen
Die vierte Schamform nennt Marks die „Gewissens-Scham“. Sie spüren wir, „wenn wir nicht in Übereinstimmung mit unserem Gewissen, den Erwartungen an uns selbst gehandelt haben. Wenn wir unsere eigenen Werte und Ideale verletzt haben“ (Marks 2024, S.43). Dahinter steht das Bedürfnis nach Integrität und sich selbst treu bleiben zu dürfen (vgl. ebd.).
Marks erläutert die Gewissens-Scham im Kontext des Lehrberufs wie folgt: „Ich bin überzeugt, dass jede Lehrkraft mit dem Wunsch beginnt: »Ich möchte einmal ein besserer Lehrer werden, als ich selbst erlebt habe.« Aber wenn es eng wird, wenn es schnellschnell gehen muss; wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen“ (Marks 2024, S.177), dann geraten Lehrkräfte immer wieder in Situationen, in denen sie sich nicht den eigenen Werten und Idealen entsprechend verhalten. Solche Situationen können durch äußeren Druck hervorgerufen werden (z.B. Noten- und Zeitdruck, Erwartungsdruck von Vorgesetzten oder Eltern) oder auch in Momenten, in denen sie akut unter starkem Stress stehen. Es entsteht dann das Gefühl einer Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, im Sinne von: „Ich wollte, ich hätte mich in der Situation anders verhalten können“.
Wenn die Unzufriedenheit über die Diskrepanz zwischen dem Anspruch und Wirklichkeit der Qualität der eigenen Arbeit auf Kolleg:innen projiziert wird, dann können Gewissens-Scham und Intimitäts-Scham (die Sorge vor Bloßstellung) in Verbindung eine besonders vereinsamende Wirkung entfalten. Jegliche Situationen, in denen ein:e Kolleg:in Einblick in die eigene Arbeit erlangt, sind u.U. stark Angst auslösend und werden vermieden. Wo dies nicht möglich ist, beispielsweise in mündlichen Prüfungen von Schüler:innen, wird das eigene Handeln daran ausgerichtet, den subjektiv empfundenen Mangel an Vorbereitung, Fachwissen oder Können vor dem kritischen Blick des oder der Kolleg:in zu verbergen. Während nach außen hin z.B. eine Fassade der Souveränität aufrecht erhalten wird, fühlt sich die betreffende Lehrkraft viel eher wie ein:e Hochstapler:in erfüllt von der Angst, jederzeit „auffliegen“ zu können.
Eine weitere mögliche Ausdrucksform dieser Problematik ist es, Kolleg:innen den Einblick in eigene Unterrichtsmaterialien zu verwehren, während man selbst mehr oder weniger wahllos Unterlagen sammelt in der Hoffnung, damit die Lücke an „schlechter Vorbereitung“ schließen zu können. Auch wenn wir zuweilen beobachten, dass wir selbst oder Kolleg:innen mit dem letztgenannten Punkt kokettieren, sind wir doch der Überzeugung, dass die Scham darüber, dass die Materialien nicht den eigenen oder den offiziellen Ansprüchen genügen, zumeist verdrängt wird.
Konstruktiv betrachtet, hilft auch hier eine positive Fehlerkultur. Ergänzt werden muss diese jedoch um eine Kultur der Selbst- und Teamreflexion, in der es zur Normalität gehört, über die eigenen Ideale und Werte in den Austausch zu kommen und womöglich zu betrauern, wenn diese in bestimmten Momenten und Situationen nicht gelebt werden konnten. Das Bemühen um die Wahrung der Integrität der Beteiligten ist hierbei essenziell.
Mögliche Auswirkungen auf das Verhalten von Lehrkräften: Schamabwehr als „Elefant im Lehrerzimmer“?
Wir können also davon ausgehen, dass Gefühle der Scham in Kontext von Schule im Prinzip allgegenwärtig sind. Zugleich bietet der systemische schulische Kontext Lehrkräften spezifische Möglichkeiten, dieses extrem unangenehme, den Selbstwert im Kern betreffende Gefühl abzuwehren, es also gar nicht als solches zu spüren. Marks (2013, S.83) zählt – unabhängig vom Kontext Schule – elf Abwehrmechanismen auf, von einer Fassade der Arroganz über die Projektion der eigenen Scham bis zum zynisch entwertenden Blick auf vermeintliche Schwächen oder Verletzlichkeit. Im Lehrerzimmer könnten sich diese Abwehrformen z.B. in Sätzen äußern wie „Was kümmert mich das Curriculum – es wird ja ohnehin alle paar Jahre eine neue Sau durchs Dorf getrieben;“ oder „Der ist schlicht zu doof und kann’s einfach nicht!“ oder „Armes Würstchen – so idealistisch war ich auch mal.“
Allen diesen Formen der Abwehr ist gemeinsam, dass sie wirkungsvolle Kooperation und an tatsächlichen Bedürfnissen von Kolleg:innen ebenso wie Schüler:innen orientierten Austausch verhindern können. So lässt sich die sprichwörtliche Figur des Lehrers als „Einzelkämpfer“ auch in diesem Licht betrachten. Scham ist also oft der „Elefant im Raum“, wenn Lehrkräfte im Lehrerzimmer miteinander sprechen. Sie besprechbar werden zu lassen, wäre ein Schlüssel auf dem Weg zu mehr Kooperation. Da Scham ein ebenso unangenehmes wie wirkmächtiges Gefühl ist, ist uns bewusst, dass hier sehr dicke Bretter zu bohren sind.
Die Forderung nach Schule als „Raum der Würde“
Wählen wir die von Marks in Rückgriff auf Salman Rushdie (1990) vorgeschlagene Metapher von der Scham als Flüssigkeit, so wird diese Flüssigkeit den individuellen Krug einer Lehrkraft unterschiedlich hoch füllen, je nachdem, welche Erfahrungen bereits mit solchen oben beschriebenen Schamprozessen bewusst oder unbewusst gesammelt wurden. Es scheint also erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um ein schulisches Umfeld zu schaffen, in dem Schamprozesse bearbeitet und besprochen werden können. Außerdem müsste das Umfeld so beschaffen sein, dass zusätzliche Scham, die den Krug noch weiter füllen würde, möglichst vermieden wird: „Die Würde eines Menschen zu achten, bedeutet damit – aus Sicht der Scham-Psychologie – ihm oder ihr überflüssige, vermeidbare Scham zu ersparen. Das bedeutet für die Pädagogik, dass es wesentlich darauf ankommt, dass pädagogische Institutionen wie die Schule Räume sind, in denen alle Beteiligten – Lehrende wie auch Schüler – Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität erfahren“ (Marks 2024, S.86). Als Begriff hierfür wählt Marks die Bezeichnung „Raum der Würde“, der uns in besonderer Weise zusagt.
Was aber braucht es, um Schule zu einem „Raum der Würde“ zu machen? Unsere Gedanken und Überlegungen, die im Rahmen der Reckahner Tagung im Herbst 2024 entstanden sind, möchten wir in einem kleinen Schaubild zusammenfassen.
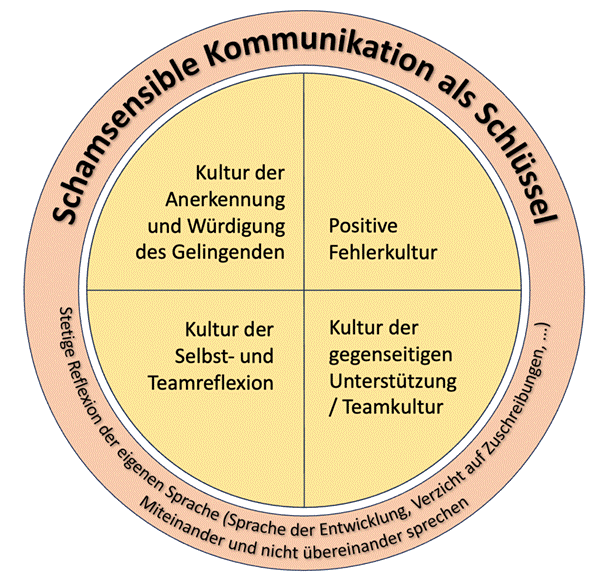
Ein „Raum der Würde“ sollte, unserer schulischen Erfahrung nach, folgende Aspekte beinhalten:
- Eine Kultur der Anerkennung und Würdigung des Gelingenden, in der das Grundbedürfnis nach Anerkennung seinen Platz hat.
- Eine positive Fehlerkultur, in der eine Atmosphäre der Sicherheit herrscht, so dass der Einzelne nicht fürchten muss, bei Fehlern bloßgestellt zu werden.
- Eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung bzw. eine generelle Teamkultur, in der das Bedürfnis nach Zugehörigkeit gelebt werden kann.
- Eine Kultur der Selbst- und Teamreflexion, in der auch über Werte und Ideale gesprochen werden darf und das Bedürfnis nach Integrität einen Raum findet.
Alle diese Kulturen müssten getragen werden von einer wertschätzenden und respektvollen Kommunikation, die als Schlüssel für jegliche Kooperation gilt. Hierzu würde unserer Auffassung nach auch die stetige Reflexion der eigenen Sprache gehören: Sprechen wir eher mit- anstatt übereinander? Sichert die von uns verwendete Sprache die Würde des Einzelnen? Kommunizieren wir so, dass es nicht aufgrund von sprachlichen Konstruktionen zu weiteren Beschämungen oder Verletzungen beim Gegenüber kommt?
Schule als „Raum der Würde“ müsste unserem Verständnis nach noch mehr den Fokus auf die kommunikativen Prozesse selbst richten und diese in die Reflexion mit einbringen. Publikationen zur vorurteilssensiblen Kommunikation in pädagogischen Handlungsfeldern sind bereits vorhanden. Unserer Auffassung nach wäre es nun an der Zeit, auch über schamsensible Kommunikation nachzudenken und diese in pädagogischen Handlungsfeldern umzusetzen.
Literatur:
Ebel, Christian (2012): „Wie muss die Schule sein, die dem Kind gerecht wird? Interview mit der Kinder- und Jugendpsychologin Oggi Enderlein über die Chancen der Ganztagsschule.“ In Schule. Lernen | Bildung im 21. Jahrhundert. Blog der Bertelsmann-Stiftung. <Abruf am 13.02.2025>
Gräsel, Cornelia; Fußangel, Kathrin; Pröbstel, Christian (2006): „Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos?“ In: Zeitschrift für Pädagogik 52 (2006) 2, S.205-219.
Grosche, Michael; Fussangel, Kathrin; Gräsel, Cornelia (2020): „Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften. Aktualisierung und Erweiterung der Kokonstruktionstheorie sowie deren Anwendung am Beispiel schulischer Inklusion“ In: Zeitschrift für Pädagogik 66 (2020) 4; S.461-479).
Hehn-Oldiges, Martina (22024): Wege aus Verhaltensfallen. Pädagogisches Handeln in schwierigen Situationen. Weinheim: Beltz.
Lesch, Harald; Zierer, Klaus (2024): Gute Bildung sieht anders aus. Welche Schulen unsere Kinder jetzt brauchen. München: Penguin.
Marks, Stephan (82024): Scham – die tabuisierte Emotion. Ostfildern: Patmos.
Marks, Stephan (2014): “Scham und Menschenwürde in pädagogischen Beziehungen.” In: Annedore Prengel und Ursula Winklhofer (Hrsg.): Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen. Band 1: Praxiszugänge. Opladen: Barbara Budrich, S.81-87.
Prengel, Annedore (22019a): Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz. Opladen: Barbara Budrich.
Prengel, Annedore (42019b): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden: Springer.